Die Ursachen von Zwängen zu klären, ist selbstverständlich auch ein Bestandteil der psychotherapeutischen Intervention bei Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Doch wie sieht eine Therapie bei Zwängen darüber hinaus aus? Wie steht es zudem mit dem Therapieerfolg welcher Maßnahmen? Einen Kurzabriss dazu geben wir euch in diesem Artikel.
Welche Therapie bei Zwängen?
Für Zwangsstörungen ist hinsichtlich der Kognitiven Verhaltenstherapie der Wirksamkeitsnachweis in Studien hinreichend erbracht worden. Es existieren Therapiemanuale, die speziell auf Zwangsstörungen zugeschnitten und ausreichend validiert sind, also empirisch geprüft. Für einzelne Zwänge (und Tics) können gegebenenfalls psychopharmakologische Therapieansätze zudem in Frage kommen. Auch dafür liegen vereinzelt empirische Wirkungsnachweise vor. Gehen wir zunächst auf eine mögliche Medikation bei Zwängen ein und wann diese angeraten sein könnte.
Medikation bei Zwängen?

Eine Kombination von Psychotherapie und Pharmakotherapie ist in Abhängigkeit vom Schweregrad möglich. © Janels Katlaps under cc
Grundsätzlich ist der Einsatz von Medikamenten bei Zwangsstörungen klinisch genauestens zu prüfen. Erwägen Kliniker eine Psychopharmakotherapie, sollte diese zuvorderst in Kombination mit einer Kognitiven Verhaltenstherapie angedacht sein. Es gibt jedoch Ausnahmen, wo die Medikation als alleinige Therapie in Frage käme. Wird zum Beispiel seitens des Patienten eine Psychotherapie strikt abgelehnt oder kann diese wegen der Schwere der Symptomatik nicht durchgeführt werden, kann aus klinischer Sicht eine Psychopharmakotherapie als sogenannte Monotherapie in Frage kommen. Langfristig ist jedoch immer eine Kombination mit einer Psychotherapie anzustreben.
Im Falle einer mangelnden Aufgeschlossenheit des Patienten gegenüber einer Psychotherapie ist zunächst das Gespräch mit ihm zu suchen. Im Mittelpunkt dessen sollten sowohl die Vorteile und der Nutzen einer Kognitiven Verhaltenstherapie stehen, als auch die Nebenwirkungen der Medikamente angesprochen werden. Ziel ist es, die psychotherapeutische Motivation (die sogenannte Compliance, also den Willen zur Mitarbeit) zu wecken. Betont wird dabei vor allem der langfristige und nachhaltige therapeutische Nutzen einer Psychotherapie gegenüber der seltenen völligen Symptomfreiheit bei einer medikamentösen Monotherapie (zumeist Reduktion um etwa ein Drittel).
Medikamente und Nebenwirkungen
Als wirksame Medikationen, die in Studien validiert sind, haben sich SSRI (sog. selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer) und Clomipramin erwiesen, wobei die Stärke der Nebenwirkungen unbedingt zu berücksichtigen ist! So geht die Verabreichung von Clomipramin unter anderem häufig mit Benommenheit, Müdigkeit, Schwindel und Kopfschmerzen einher genauso wie mit Zittern und unwillkürlichen Muskelzuckungen. Auch Sprachstörungen, Angstzustände und Halluzinationen können vorkommen.
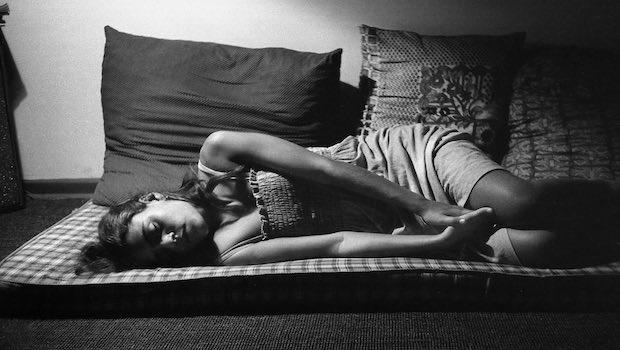
Viele Medikamente gegen Zwänge haben Nebenwirkungen wie Müdigkeit etc. © Carlos Ebert under cc
Zwar treten die genannten anticholinergen Nebenwirkungen der älteren trizyklischen Antidepressiva bei den SSRI nicht auf. Dennoch kann es auch bei diesen zu Kopfschmerzen, Unruhe, Schlafstörungen etc. kommen. Zudem sprechen einige Studien dafür, dass die Suizidgefahr bei Kindern und Jugendlichen in Zusammenhang mit SSRI-Gabe erhöht sei, demzufolge eine Medikation für diese Altersgruppen nur mit speziell dafür zugelassenen Medikamenten erfolgen darf sowie einer ausreichenden therapeutischen Überwachung. Auch bei Erwachsenen wird ein mögliches erhöhtes Suizidrisiko in Verbindung mit SSRI in der Forschungswelt diskutiert.
Kognitive Verhaltenstherapie bei Zwängen
Für Zwangsstörungen wurden speziell zugeschnittene Kognitive Verhaltenstherapien entwickelt, die sowohl im Einzel- als auch im Gruppensetting sich als wirksam erwiesen. Im praxistherapeutischen genauso wie im klinisch-stationären Kontext finden diese Therapien bei Zwängen ihren Einsatz.
Ziel einer Kognitiven Verhaltenstherapie ist es, Einstellung und Verhalten umzulernen. Durch Erkenntnisgewinnung, kognitiver Arbeit und Verhaltenstrainings wird eine Verknüpfung neuer Assoziationen im Gehirn erreicht, welche neue Verhaltensweisen mit sich bringt.
Innerhalb des kognitiv-verhaltenstherapeutischen Interventionsansatzes kommt die Exposition mit Reaktionsmanagement zum Tragen. Wie sieht dieser psychologische Baustein einer Therapie bei Zwängen aus? Nachfolgend nehmen wir darauf Bezug.
Exposition und Reaktionsmanagement
Die sogenannte Exposition meint das wiederholte Darbieten von zwangsauslösenden Stimuli beziehungsweise Reizen. Diese können extern aber auch intern getriggert sein. Die Darbietung ist auf einem Kontinuum angesiedelt, von sukzessiver Reizsteigerung bis hin zur kontrollierten Reizüberflutung. Die Betroffenen müssen nun im schützenden therapeutischen Rahmen (beziehungsweise in Begleitung des Therapeuten außerhalb) ihre Reaktion auf diese Stimuli neu lernen. Bisher reagierten die Zwangspatienten auf einen reizauslösenden Stimulus mit einer Zwangsreaktion zur Kompensation.
Vereinfacht heruntergebrochen: Beispielsweise reagiert ein von einem Zählzwang Betroffener auf Stress mit ebenjenem Zählen. Tut er dies und löst sich dadurch die Anspannung auf, so wird diese Verhaltensweise belohnt. Psychologen sprechen von einer negativen Verstärkung. Das Gehirn lernt: Wenn ich auf Reiz X mit Verhalten Y reagiere, fühle ich mich kurzfristig besser! Die Folge: Immer häufiger kommt Verhalten Y bei Reiz X zur Anwendung und wird zunehmend automatisiert.

Therapie bei Zwang: maximale Unordnung herstellen und aushalten. Ganz so schlimm sollte es sicher nicht aussehen.;) © Rolf Dietrich Brecher under cc
In der Therapie versucht man nun, mit Verhalten Z auf Reiz X zu reagieren. Das Gehirn der Betroffenen muss umlernen, die negative Verstärkung sozusagen aufbrechen. Während der Reizkonfrontation darf weder laut noch in Gedanken mit Zählen reagiert werden. Ein Grund, warum die Compliance bei Zwangserkrankten in der Therapie so wichtig ist, weil der Therapeut die Gedanken selbstredend nicht nachkontrollieren kann. Der Patient schließt sozusagen einen Vertrag mit sich selbst.
Hausaufgaben in der Therapie
Auch im Alltag muss sich der Patient einem Umlernen der Zwangshandlungen stellen. Beispielsweise muss er mindestens einmal am Tag sein Auto auf dem Parkplatz abstellen, ohne nachzukontrollieren, ob es abgeschlossen ist. Oder er muss sein Zimmer maximal unordentlich machen und diesen Zustand für eine bestimmte Dauer aushalten.
Die klinische Empfehlung sieht vor, die Exposition mit Reaktionsmanagement solange fortzuführen, bis eine signifikante therapeutische Besserung eingetreten ist, zum Beispiel eine Reduktion der Zwangsgedanken, -handlungen um die Hälfte beziehungsweise allgemein eine Verbesserung der Lebensqualität. Begegnet der Patient der Therapie bei Zwängen mit hoher Bereitschaft und Ausdauer, so steht einem nachhaltigen Therapieerfolg nichts im Wege.


