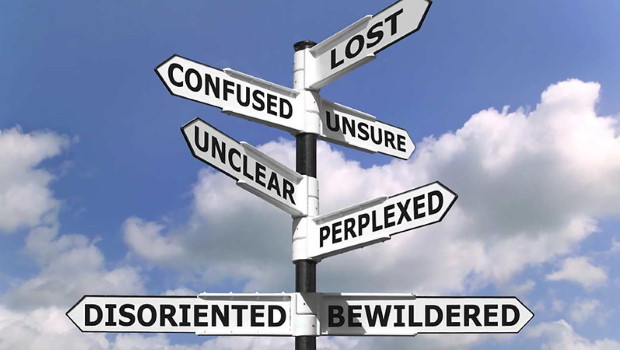
Was uns fehlt, wenn wir etwas ändern wollen, ist eine klare Richtung. © Wonder woman0731 under cc
Wenn wir etwas ändern wollen, fühlen wir uns oft allein gelassen. Gerade, wenn wir erkennen, dass es schwerlich so weiter gehen kann.
Aufgaben, die auf uns zukommen, gibt es derzeit mehr als genug. Die Gewichtung ist ganz sicher bei der einen anders, als beim anderen, aber viele fühlen eine Art innerer Verpflichtung, etwas zu tun. Es gibt jene, die den Eindruck haben, dass das, was sie selbst tun können zu wenig oder zu spät sei. Manchmal ist auch das nur eine Form der Selbstbeschwichtigung, weil man (noch) nicht selbst etwas tun will.
Andere verweigern sich offen, zuweilen etwas trotzig, manchmal, weil das Leben ihnen nichts geschenkt hat und sie deshalb nicht fühlen, hier etwas (zurück) geben zu sollen. Vermutlich ein etwas zu kurz gesprungener Ansatz, aber hier nicht das Thema. Erfreulich viele Menschen sind motiviert, die Welt besser zu machen.
Der Blick aufs Ganze und aufs Detail
Wie öfter erwähnt spricht viel dafür, dass eine echte Veränderung des Bewusstseins, im Sinne einer Entwicklung (nicht nur der Wechsel dessen, was man gerade toll findet) einer der stärksten Faktoren für Veränderung ist. Doch die Blicke aufs Ganze und aufs Detail schließen sich nicht aus, im Gegenteil, sie bedingen einander.
Wer ein Gefühl für die Entwicklung des Ganzen bekommen hat, möchte in aller Regel auch etwas in seinem gewohnten Umfeld verändern. Wer das jedoch ernst nimmt und nicht einfach irgendwas tun möchte, weil viele andere auch irgendwas tun, der fühlt sich oft allein gelassen, weil in vielen Kontexten unklar ist, was nun etwas bringt und wie viel.
Häufig hört man, was alles nicht gut fürs Klima ist, zu viel Müll produziert, sozial mehr oder weniger unpassend erscheint, aber die Auswirkungen des Effekts werden oft nicht klar. Statt dessen hören wir von mehr oder weniger diffusen oder präzisen Ziele, die wir schnell erreichen müssen, aber nicht, wie wir sie zielgerichtet erreichen können und kaum einer weiß, was er tun sollte um wenigstens seinen Teil zum Gelingen beizutragen.
Mal auf die Urlaubsflugreise und Plastiktüten verzichten, dann und wann das Fahrrad nehmen und weniger Fleisch essen, reicht das? Oder ist das eher Symbolpolitik, ins Private verlagert? Aber selbst ein Programm wie das von Dirk Gratzel führt am Ende des Tages zwar zu einer sehr deutlichen Reduktion des Klima-Fußabdrucks, aber es ist noch nicht ausreichend, um auf das zu kommen, was der Planet ertragen kann. Und mehr geht kaum, wenn man nicht im Wald leben will.
Also, was sind die wirklich effektiven Schritte, wenn wir etwas ändern wollen? Das müsste leichter zu finden sein, klarer und öfter verbreitet werden.
Beispiel Klima
Ist es besser sein Essverhalten umzustellen, sein Mobilitätsverhalten oder die Art und Häufigkeit des Einkaufs? Was von den Schritten bringt wirklich was, was ist eher Augenwischerei? Was sollte man tun, wenn man einen großen Schritt gehen will und nicht sieben bis zehn kleine, von denen man Montags hört, sie seien gut und Mittwochs, sie würden eigentlich gar nichts bringen?
Das Problem ist, dass man sich nicht selbst in jedes Thema knietief einarbeiten kann, dafür sind es einfach zu viele geworden und sie sind in sich sehr komplex.
Beispiel Biodiversität
Ein einfaches Beispiel sind die Blühstreifen am Rand von Feldern. Die Idee ist, den Insekten wieder ein Stück weit den Lebensraum zurück zu geben, den man ihnen durch Monokulturen genommen hat. An sich gut, nur kritisieren einige, die sich mit dem Thema wirklich auskennen, dass die dort verwendeten Mischungen gar nicht gut auf unsere heimischen Insekten abgestimmt sind. Gut gemeint, aber nicht so gut gemacht.
Die Lösung ist in dem Fall einfach, man muss die Blütenmischungen so anpassen, dass gerade hier heimische Insekten davon profitieren und je mehr das wissen und gezielt nachfragen, umso mehr steigert sich die Nachfrage, die in einigen Bereichen das Angebot steuert.
Doch irgendwann reagieren einige von uns jedoch gereizt bis genervt, weil es immer wieder Menschen gibt, die in jeder Suppe ein Haar finden und denen man scheinbar nichts recht machen kann. Jetzt gibt man sich schon Mühe – und wieder nichts.
Gesunder oder intelligenter Egoismus ist nicht verkehrt
Zum einen ist das eine Frage der Kommunikation. Es wäre gut, die Bemühungen anderer zu erkennen und auch erst mal anzuerkennen, vielleicht sogar zu loben, bevor man hinein grätscht und kritisiert. Kritik mag ein Wert an sich sein, aber so, wie sie oft vorgetragen wird, herablassend und moralisierend, ist sie immer misslungen.
Diejenigen, die sowieso ungern etwas für andere machen, werden an der Stelle leicht frustriert. Sie schmeißen dann die Flinte ins Korn und ziehen sich mürrisch bis trotzig zurück. Dass andere Anerkennung brauchen, ist ja an sich kein Makel, man sollte sie ihnen zukommen lassen, nur nicht bei allem was sie tun, sondern, wenn sie verdient ist.
Auch das ist Umweltschutz. Umwelt besteht nicht nur aus Bienen, Blumen und Bäumen, sondern auch die Mitmenschen und unsere Kommunikation mit ihnen zählt zur Welt, die uns umgibt. Es mag uns ärgern, wenn jemand bei allem fragt, was er denn davon hat, wenn er das tut. Doch es gibt durchaus einen gesunden oder intelligenten Egoismus, der vielleicht helfen und die Welt besser machen will, aber eben auch fragt, was sein Gewinn dabei ist.
Statt angesäuert zu reagieren ist es besser, dies entspannt zu beantworten. Denn in sehr vielen Fällen profitiert man natürlich auch selbst davon, wenn es anderen besser geht. Dabei geht es nicht nur um die Anerkennung die man auf dem Weg dann tatsächlich verdient bekommt, wenn man etwas für andere tut. Etwas, was den auf Bequemlichkeit gedrillten Egoisten oft entgeht und sie vereinzelt. Sondern es ist offensichtlich, dass die Probleme der globalisierten Welt immer auch unsere sind. Seuchen und Klima sind ja nun dauerpräsent und es ist unser Interesse, dass nicht am anderen Ende der Erde eine richtig fiese Corona-Mutation entsteht, die dann schneller hier ist, als wir es glauben möchten.
Wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir auch diese Zusammenhänge begreifen und sie immer wieder ventilieren. Auf diese Weise kann ein gesunder Egoismus entstehen, der für sich etwas einfordert, ohne dabei andere aus dem Blick zu verlieren. Das zieht sich durch alle inneren, äußeren und zwischenmenschlichen Bereiche der Wirklichkeit.
Wir sollten wissen, wie wir Praktiken stärken können, von denen alle profitieren. Das ist am Ende nicht immer wahnsinnig kompliziert. Wieder deutlich mehr Roggen zu essen ist so ein einfacher Punkt. Roggen ist für uns gesünder, besser für die Umwelt und die Vielfalt der Getreide und des Geschmacks. Breite Effekte, durch geringe Veränderungen.


