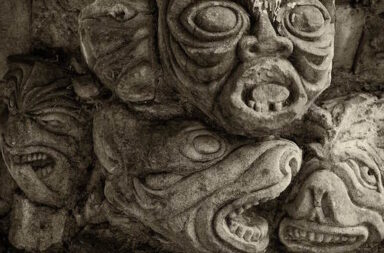Die Stradivari: seit mehr als 300 Jahren ein Inbegriff für Spitzenqualität, bis heute. © Håkan Svensson under cc
Dass Klischees uns bremsen, kann man in vielen Bereichen des Lebens sehen und exemplarisch nachweisen.
In aller Regel handelt es sich dabei um die Behauptung einer vielfach wieder modern gewordenen Ausschließeritis, nach der man entweder nur in die eine oder andere Richtung denken, fühlen und handeln kann.
Was gesund ist, macht keinen Spaß und was Spaß macht, ist ungesund
Das ist die klischeehafte Zuspitzung von Gesundheitsempfehlungen in denen es in der Vergangenheit oft hieß, dass Genussmittel eingeschränkt werden sollten. Gemeint waren damals fettes Essen, Alkohol und Tabak, empfohlen wurden Mäßigung und mehr Bewegung. Die Folgen der Maßlosigkeit waren Übergewicht, Bluthochdruck und Herzinfarkt, auf der anderen Seite gab es natürlich einen gesellschaftlichen Gewinn – zeigen zu können, dass man es geschafft hat – der Herzinfarkt galt mal als die Managerkrankheit, heute kann ihn sich jeder leisten.
Aber das Klischee ist in den Köpfen, Spaß oder Gesundheit, man muss sich entscheiden. Ein anderes auch: Wenn man den gesellschaftlichen Aufstieg erreicht hat, kann man auf die Regeln für der anderen pfeifen. Und irgendwie schien das eine Regel der Erfolgreichen zu sein, auf konventionelle Vorgaben zu pfeifen. Das kann man auch falsch, nämlich verkürzt verstehen, dann hat man die Idee, dass schon der Bruch der Regeln ausreicht, um besonders toll zu sein. Aber häufig ist man nur peinlich, weil vergessen wurde, dass Kreativität und Originalität ebenfalls dazugehören. Man sollte das Konventionelle über- und nicht unterbieten.
Der Zigarre rauchende dicke Mensch ist wenigstens bei uns heute nicht mehr angesehen, moderne Manager sind schlank und demonstrativ gesund, Übergewicht bis zur Adipositas ist eine Krankheit der Armen geworden, wie auch übermäßiger Tabakkonsum, nur Alkohol wird quer durch alle Schichten getrunken.
Sex bleibt immer unerwähnt, schwingt in dieser Unerwähnheit allerdings mit. Im Klischee sollen Genießer gegen Asketen ausgespielt werden. Ein Stück weit mag das stimmen, aber wenn man es überzieht, hängt Genuss von der Menge ab. Wer sich als Genießer definiert ist im besten Fall auch einer, im weniger guten dann irgendwo in Richtung Sucht unterwegs. Aber auch wenn Genussmittel zur Gewohnheit geworden sind, ist die Frage, ob sie noch mit Genuss verbunden sind. Wer nicht genießen kann, wird ungenießbar, auch da ist was dran, letztlich muss man selbst entscheiden, wo man steht.
Es wird oft darauf verwiesen, dass man sich nur – ganz achtsam – auf diese eine Sache, den einen Reiz konzentrieren sollte. Wenn es so ist, dass man von einem Eindruck, einer Tätigkeit ganz absorbiert ist, ist das okay, vielleicht sogar toll, aber ich werde immer skeptischer, ob man das so hoch hängen und eine Vorschrift oder ein eigenes Klischee draus machen sollte. Die zentrale Frage ist, ob man etwas genießt und wenn man das mit dem Buch und der Schokolade in der Wanne hinkriegt, ist das auch in der Kombination ein privates Glücksritual, gegen das nichts spricht.
Man ist egoistisch oder sozial
Auch das ist oft ein Klischee. Ein inzwischen bekannter und – bezogen auf die Ergebnisse – schon wieder kassierter Test für Kinder, ist der mit einer kleinen, sofortigen Belohnung oder der Aussicht auf eine größere Belohnung, wenn man dem sofort verfügbaren Reiz widersteht.
Abgehen davon, dass die Überprüfung nicht beeindruckend ausfiel, mit der ersten Interpretation meinte man zeigen zu können, dass die Fähigkeit zur Impulskontrolle in jungen Jahren, auch später dazu führt, dass man erfolgreicher wird. Aber erfolgreich zu sein, heißt nicht unbedingt sozial zu sein. Im Grunde ist die Aussicht auf späteren, umso größeren Erfolg – weil man artig lernt oder übt, wenn andere spielen oder feiern – ja nur ein gezähmter Egoismus. ‚Meine Stunde kommt, euch werd‘ ich’s zeigen.‘ Das kann auch ein Amokläufer denken.
Aber Egoismus muss nicht mal unsozial sein. Wer sich bescheuerten Anweisungen verweigert kann das aus mitmenschlichen, aber auch egoistischen Gründen tun. Das muss nicht falsch sein und kann sogar anderen nützen, die sich dann ebenfalls trauen sich zu verweigern, zu protestieren, für sich einzustehen. Selbst wenn jemand einfach nur für sich keine Lust hatte.
Dennoch ist es ebenfalls falsch, dass jede gute Tat im Kern egoistisch ist, weil man es angeblich nur auf Lob, Anerkennung oder ein eigenes gutes Gefühl abgesehen hat. Warum ist es über die Behauptung hinaus falsch? Weil die These nicht zu widerlegen ist. So betrachtet ist man immer Egoist und wenn man Menschen fragt, die Gutes tun, warum sie es machen und behauptet, es sei ihnen eben selbst nicht klar, warum sie tun, was sie tun, ist man doppelt unfalsifizierbar. Fragt man sie aber tatsächlich, so ergibt sich ein Spektrum an Motiven für Handlungen, von rein egoistischer Natur, bei denen man versucht, das eigene Wohlergehen zu vergrößern – gleich, ob das anderen nützt oder schadet – bis zur altruistischen Absicht das Wohlergehen anderer zu vergrößern – gleich, ob einem selbst das nützt oder schadet.
Auch hier kommt es also vor, dass Klischees uns bremsen ein differenziertes Bild zu entwerfen. Was mir hilft kann allen helfen, was mir Spaß macht, kann ebenfalls allen dienen oder einfach Freude bereiten.
Wie gut gefällt mir mein Leben eigentlich?
Oft kann die eigene Lebensbilanz, nicht nur am Ende des Lebens, durchaus gut und wichtig sein. Manchmal neigen wir dazu uns selbst etwas vor zu machen, vielleicht auch aus den nachvollziehbaren Gründen uns vor Enttäuschungen schützen zu wollen. Manche Menschen haben turmhohe Ansprüche an alle Bereiche ihres Lebens, es ist unwahrscheinlich, dass so ein Ansatz gut ausgeht, die Latte über die man muss, liegt einfach zu hoch. Der Anspruch auf Perfektion ist nicht selten auch eine Kompensation, gegen das kränkende Gefühl, dass es so wie es und wie man ist, nicht gut genug ist.
Aber muss mein Leben sensationell und perfekt sein? Warum reicht es nicht aus, dass man einfach nur zufrieden ist, gerne lebt? Wir kennen die ‚richtige‘ Antwort, auch wenn wir fühlen, dass wir mehr verdient hätten, eigentlich. Viele verachten den Durchschnitt, je narzisstischer sie sind, umso stärker. Wenn wir davon mal absehen: Ist mein Leben hier und heute, das was meinen Träumen, wenigstens annähernd entspricht? Wer krank, arm und allein ist, wird diese Frage kaum mit ‚Ja‘ beantworten, aber wie ist es mit Ihnen? Es geht weder um ein eindeutiges ‚Ja‘ oder ‚Nein‘, viel mehr um eine Tendenz.
Könnte ja sein, dass Sie halbwegs gesund und zufrieden sind, aber sich Sorgen wegen der Weltlage machen: Corona, Krieg und Klima, Überbevölkerung, stark polarisierte Meinungen im Alltag. Wenn es irgendwie eng zu werden droht, verschließen wir – aus Angst daran sowieso nichts ändern zu können – die Augen und spielen Normalität. Das ist nicht immer falsch, weil die Normalität eine erstaunliche Kraft ist und hat, aber einfach weiter zu machen kann auch zur Verdrängung werden, wenn genau diese Normalität uns in die Krise gebracht hat. Doch grade dann ist es wieder so, dass Klischees uns bremsen, weil man einfach mitmachen muss. So meinen es in regressiven Zeiten viele.