
Gewalt scheint nötig zu sein, um Gewalt zu reduzieren, aber sie sollte minimiert werden. © wwwuppertal under cc
Pazifisten werden gerade gerne überhört. Doch auch bei ihnen gibt es nicht das eine Motiv, sondern sehr unterschiedliche.
Die Zeiten sind verrückt und bedrückend. Haben wir eben noch über R-Werte, Inzidenzen und Impfungen diskutiert, lernen wir nun was leichte Waffen, Ringtausch und Militärstrategien sind. Grund genug mal wieder schüchtern darauf hinzuweisen, dass es ja auch noch Frieden als Option gibt, aber die Motive der Pazifisten sind nicht automatisch und immer so edel, wie sie klingen.
Soll heißen, Pazifismus ist kein moralischer Selbstläufer. Im Grunde meines Herzens bin ich auch Pazifist, ich finde bewaffnete Auseinandersetzungen überflüssig und meine, dass es bei weitem genug Leid in der Welt gibt. Ich bin nur selbst unsicher, wie weit man diese Position belasten kann und mich hat Navid Kermani mal in einem Interview beeindruckt, als er zu den Motiven eines Buches gefragt wurde, das er geschrieben hat und antwortete, dass er am Anfang auch nicht gewusst habe, was am Ende dabei heraus kommt, wenn er es gewusst hätte, hätte er kein Buch darüber zu schreiben brauchen.
Auch der Philosoph Olaf Müller, von dem gleich noch die Rede sein wird, legte sich die Aufgabe vor, seine pazifistische Position zu prüfen und in einem Essay zu verteidigen. Also versuche ich es auch so, nur knapper. Aber der Reihe nach.
Die Instrumentalisierung des Pazifismus
Ich will die Güteklassen der Argumente, wie sie mir erscheinen gerne sortieren, so, dass sie immer besser werden und werde sicher einige Aspekte dabei übersehen.
Das gar nicht überzeugende Argument ist das der achselzuckenden Gleichgültigkeit mit der einige sagen, es sei nicht unser Krieg und dass wir uns aus dem Grunde heraus halten sollen. Bisweilen kann man eine Identifikation mit dem Aggressor unterstellen, manchmal vielleicht sogar Sympathie, jeder ist anders geprägt, es gibt verschiedene Traditionslinien die wahlweise die Amerikaner, Deutschland oder den Westen als den Urgrund des Bösen ansehen und davon auch niemals abweichen, manchmal verbunden mit verschiedenen Ausprägungen des Antisemitismus.
Ebenfalls ohne Überzeugungskraft ist die Willkür mit der man in jeder passenden und unpassenden Situation einen Einwand als Whataboutism, also eine Form der Ablenkung von dem Thema, das man sich eigentlich vorgelegt hat, ansieht, um dann bei dem russischen Angriffskrieg sofort auf ‚den Westen‘ und seine Verfehlungen zu verweisen.
Ohne ideologischen Hintergrund ist diese Einstellung eher unterkühlt bis narzisstisch, der Tenor ist: Was interessieren mich die anderen, wenn ich selbst Nachteile davon haben könnte? Das überzeugt nicht, weil man im Fall eigener Betroffenheit die Hilfe anderer sofort einfordern würde, aber auch wenn man es nicht tut: Die Perspektive des Lebens als Kampf aller gegen alle ist ebenfalls nicht überzeugend, wie in Aggressives oder friedliches Verhalten: Wer gewinnt? ausgeführt.
Die Angst um das eigene Leben
Die Angst um das eigene Leben ist ein Motiv, was man nachvollziehen kann. Pazifisten müssen keine Helden sein, aber es ist kein genuiner Pazifismus, wenn man um sein eigenes Leben fürchtet. Es ist jedoch sehr gut verständlich, wenn jemand denkt oder sagt: Ich habe eine Scheißangst zu sterben, erst recht vor einem Atomkrieg und da ist mir eigentlich jeder Weg egal, Hauptsache, es wird nicht mehr gekämpft.
Das Problem dieser Sichtweise beginnt in dem Moment, wo man sich fragt, ob man eigentlich der einzige Mensch auf der Welt ist, der diese Einstellung haben darf. Solange man denkt, dass der Nachbar das gleiche meint, ist es unproblematisch, aber dürfen Ukrainer diese Einstellung nicht auch für sich in Anspruch nehmen? Die andere Seite der Einstellung ‚Frieden, egal wie‘ ist nämlich, dass sich gegebenenfalls andere Menschen für mich opfern sollten, auch wenn sie ihr Leben verlieren. Das wäre die Konsequenz, wenn man eine Position für sich selbst in Anspruch nimmt – aus Angst um das eigene Leben – die man den Ukrainern abspricht.
Die goldene Regel oder Kants kategorischer Imperativ sagen, dass man von anderen nicht verlangen sollte, was man selbst nicht leistet und zudem, dass man für sich nichts beanspruchen sollte, was man anderen verwehrt. Es sind die Grundlagen, auf die sich unsere Gesellschaft zumindest offiziell beruft, die Symmetrie des Rechts und der Gerechtigkeit.
Argumentative Probleme der Pazifisten
Es gibt eine pazifistische Position, die heute schwer zu halten ist, der gesinnungsethische Pazifismus. Sein Inhalt: Komme was da wolle, Gewalt ist immer falsch. Olaf Müller weist diese Position für sich selbst ebenfalls zurück, bezeichnet sie als selbstüberheblich und arrogant.
Die Position zerschellt auch, wenn es Menschen auf der Welt gibt, die keine Pazifisten sind und andere überfallen und umbringen. Der Pazifist kann dann hoffen, dass diese irgendwann zur Einsicht kommen oder andere die Aggressoren aufhalten. Man selbst hätte sich dann nicht die Finger schmutzig gemacht und ganz nebenbei auch das eigene Leben nicht in Gefahr gebracht. Man macht sich einen schlanken Fuß, während man anderen die Drecksarbeit zumutet, mir scheint das in dieser Variante einfach eine weitere narzisstische Einstellung zu sein.
Aber das ist vielleicht die letzte pazifistische Position, die man problemlos abräumen kann, ansonsten hat der Pazifismus schon von daher einen Punkt, weil er einen starken moralischen Wert an sich darstellt: Keine Gewalt, zumindest keine Gegenwehr mit Waffen und wenn schon, dann so sparsam, wie es eben geht.
Olaf Müllers Pazifismus
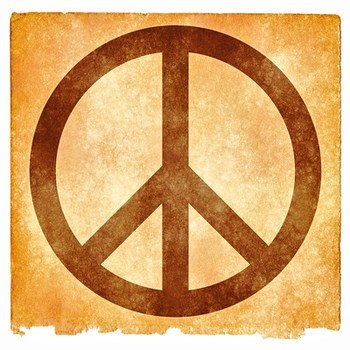
Ein ikonisches Zeichen des Friedens, den wir hoffentlich bald feiern können. © Nicholas Raymond under cc
Müller sagt, die Gegenwehr mit Waffen sei nicht der bessere Weg, man könne andere und kreative Formen des Widerstands finden. Das Argument und sein Beispiel laufen in letzter Konsequenz darauf hinaus, dass Menschen nicht einfach andere Menschen töten, die sich nicht wehren. Vielleicht hier und da in geringer Zahl, aber nicht im großen Stil. Ob man nun allen Betroffenen zumuten kann, es auf dieses Experiment kreativer Widerstandsformen ankommen zu lassen, da wäre ich etwas im Zweifel.
Müllers Argument: Wir wissen nicht, was die Folgen der Waffenlieferungen sein werden. Er spricht davon, dass diese Folgen hinter einem Schleier des Nichtwissens verborgen seien und dass alle, die meinen, sicher zu wissen, was passieren wird, letztlich von einer Warte aus argumentieren, die sie nicht einnehmen können, weil sie es nicht wissen. Dieser Punkt stimmt und seine Vorsicht ist für mich nachvollziehbar.
Er sieht im wesentlichen zwei Gefahren bei zusätzlichen Waffenlieferungen: 1. die Zahl der Opfer auf allen Seiten und 2. ein Atomschlag.
Zum Punkt 1: Müller argumentiert einmal optimistisch, im Bezug darauf, dass die russische Armee keinen Völkermord und auch keine Massentötungen begangen hätten und beruft sich auf ein negatives Menschenbild, was hinter solchen Vermutungen stecken würde. Angesichts unserer eigenen Geschichte, in der industrialisierte Tötungen im großen Stil Realität waren, weiß ich nicht, ob ein Pessimismus nicht auch eine realistische Position sein kann. Man muss diesen Punkt nicht rassistisch interpretieren, ein Blick auf die Möglichkeit von Massenregressionen würde reichen, dies wäre einer, den man ohnehin nicht übergehen sollte.
Philosophisch sehe ich hier allerdings einen performativen Selbstwiderspruch, denn Müller argumentiert an dieser Stelle von einer Position des Nichtwissens aus, die er an der anderen Seite kritisiert. Sein weiterer Punkt ist dann auch zu sagen, dass wir es auf einen Optimismus ankommen lassen sollten, lapidar gesagt: So schlimm wird es schon nicht werden, solange man sich nicht mit Waffengewalt wehrt. Man kann das mehr oder weniger überzeugend finden, ich meine jedoch, dass Müller hier in letzter Konsequenz selbstwidersprüchlich argumentiert, dazu später.
Ist Überleben eigentlich der höchste Wert?
Olaf Müller kennt die Gegenargumente und führt an, dass es extrem schwer sei die Frage der (Zahl der) Menschenleben aufzuwiegen gegen die Fragen von Diktatur, Fremdbestimmung und Unterdrückung.
Müller betont die Schwierigkeit der Abwägung von Werten, nimmt sie aber in einem performativen Selbstwiderspruch zugleich für sich in Anspruch, wenn er von einer Obergrenze der Toten für den Preis der Unabhängigkeit spricht. Diese Obergrenze der Toten ist ja eine Abwägung von Werten, indem sie implizit behauptet, Freiheit und Selbstbestimmung seien ja schön und gut, aber nicht um jeden Preis.
Bewegen wir uns kurz von Müllers Position weg, hin zur Diskussion um die Coronapolitik, die uns allen noch sehr gut bekannt ist. Was mich gelegentlich gewundert hat, war, dass oft die Menschen, die von einer drakonischen Einschränkung der Freiheit durch die Coronapolitik sprachen – und die hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand dann auch mal sagten, dass Opa ja auch schon sehr alt ist und man das mit dem Überleben dann doch nicht zu hoch hängen sollte, wenn auf der anderen Seite der Waagschale die Freiheit auf dem Spiel steht – nicht selten jene sind, die nun das Überleben absolut setzen und die Freiheit nicht mehr so wichtig nehmen.
Wir reden auch von Menschen, die als völlig unzumutbare Einschränkung ihrer Freiheit empfanden, wenn sie einen Supermarkt mit einer Atemschutzmaske betreten mussten, aber eine gravierende Einschränkung der Freiheit, einen Diktatfrieden gegen den auch Habermas sich explizit wendet, will man den Menschen der Ukraine problemlos zumuten. Ein argumentativer U-Turn.
Wolfgang Schäuble hatte während der Corona Pandemie darauf hingewiesen, dass im Grundgesetz die Würde des Menschen eine herausragende Position einnimmt, mit dem angedeutenden Unterton, diese sei gegebenenfalls stärker zu gewichten, als das nackte Überleben. Das mag ein diskutables Argument sein, aber wie es sich im Einzelfall verhält, hat stets der betroffene Mensch zu entscheiden, nicht jemand für ihn und damit über seinen Kopf hinweg. Das gilt auch im gegenwärtigen Krieg so, die Überfallenen haben zu entscheiden, was ihnen ihre Freiheit wert ist.
Dass wir nicht für die Ukraine und ganz generell für betroffene andere Menschen oder Staaten entscheiden dürfen, sieht Müller auch so, sein Punkt ist an der Stelle, dass wir als Waffenlieferanten mit im Spiel sind und es an der Stelle eine Obergrenze an Opfern geben muss, wo immer man diese zieht. Dass diese Grenzen willkürlich sind, ist der eine Punkt, aber ich halte es für problematisch von einer prinzipiellen Argumentation, dass jemand seine Freiheit selbst verteidigen können soll, zu einer utilitaristischen Sicht umzuschwenken, die dann bei Opferzahl x halt macht und hofft, dass es schon nicht so schlimm werden wird.
Denn in dem Fall hätte man erst viele Todesopfer auf beiden Seiten und dann den Verlust der Freiheit, die noch höher wiegen soll oder zumindest einen weiteren fundamentalen Wert darstellt. Zudem: ob es nicht so schlimm wird, weiß man leider auch nicht. In vielen Ländern auf der Erde sind Menschen es aktuell gerade leid, in einer Diktatur zu leben und opfern lieber ihr Leben, statt so weiterleben zu müssen.
Formen des kreativen Widerstands
Olaf Müller formuliert aber auch einen positiven Gegenentwurf. Zum einen zitiert er einen katalanischen Wissenschaftler, der ein paar hundert kleinere Beispiele erfolgreichen zivilen Widerstands enthält. Das stärkste Beispiel (ab Minute 13:13 des Interviews) beeindruckt, aber es fand etwa einen Monat nach dem Angriff statt, im März 22.
Müller kritisiert, dass diese positiven Beispiele eines kreativen, zivilen Widerstands in der Öffentlichkeit völlig unter den Tisch fallen und ich würde in jedem Fall zustimmen, dass man diese oft improvisierten Formen weiter ausprobieren und stärken sollte, parallel zu einer Aufrechterhaltung und Stärkung diplomatischer Ansätze und einem Kontakt der Militärs der Länder.
Auf diesen Beispielen aufbauend stellt Müller zwei Positionen dar, eine pessimistische: Der Mensch ist an sich schlecht oder böse und eine optimistische: „Der Mensch ist ín sich gut und wird nur unter Beschuss immer weiter brutalisiert.“[1] Er rekurriert auf Weisheitslehrer, die diese Position schon seit ewigen Zeiten vertreten würden. Aber tun sie das?
Viele Weisheitslehren sehen diese Welt als einen Ort an, der an sich nicht zu retten ist, dennoch kann man das Leid versuchen zu lindern und auch in optimistischen Versionen ist stets das eigene Bemühen gefordert. Aber sind wir wirklich ratlos im Bezug auf die Frage nach der ‚Natur‘ des Menschen? Die moderne Psychoanalyse und Anthropologie weisen uns den Weg.
Die Psychoanalyse sagt, mit Kernberg:
„Doch ist die eingangs zitierte Sichtweise – ein hartnäckiges Festhalten der westlichen Welt an einigen konventionellen Mythen – durchaus zutreffend. Das betrifft
- den Mythos von der sexuellen Unschuld des Kindes,
- den Mythos, dass der Mensch von Grund auf gut ist, sowie
- den Mythos, dass bei einer menschlichen Begegnung zumindest eine der beiden Parteien der anderen zu helfen bemüht ist.
Max Gitelson fasste dies in einfachen Worten zusammen: „Es gibt viele Menschen, die an die Psychoanalyse glauben, außer wenn es um Sex, Aggression und Übertragung geht.“[2]
Der Anthropologe Michael Tomasello kann überzeugend darstellen, dass es den Menschen auszeichnet ultrakooperativ zu sein und dass es unterm Strich die ohnehin unauflösbare Mischung aus Natur und Kultur ist, die entscheidet, welche Richtung dominiert.
Die weiteren Formen der Möglichkeit der gesteigerten Aggression, vor allem die Regression der Massen, lässt Müller unerwähnt und es muss auch die Frage gestellt werden, ob bezahlte Söldnertruppen ebenso leicht zu besänftigen wären, wie vielleicht ein bunt zusammen gewürfelte Truppe von jungen Männern, die noch gar nicht begriffen haben, warum sie eigentlich kämpfen. Ein Jahr später ist allen klar, dass ein blutiger Krieg herrscht.
Argumentative Schwachstellen in Olaf Müllers Pazifismus

„Denn vernünftige Wesen stehen alle unter dem Gesetz, dass jedes derselben sich selbst und alle andere niemals bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst behandeln solle.“ Ein philosophisches Erdbeben. © Skara kommun under cc
Olaf Müllers Argumentation hat in meinen Augen ein paar entscheidende Schwachstellen.
Insgesamt beruft er sich auf zwei Positionen, einmal die des Nichtwissens, eine Position die klarerweise richtig ist, aber für alle Seiten gilt. Diese kombiniert er mit einem optimistischen Menschenbild, das im Kern besagt, der Mensch könne keine Großtötungen begehen, wenn die andere Seite nicht mit Gewalt antwortet. Die Nazidiktatur sei die eine geschichtliche Ausnahme gewesen.
Ich meine, dass der Punkt, dass der Mensch nur unter Beschuss brutal wird schlicht und einfach unüberzeugend ist und Aggression immer eine Grundkraft des Menschen darstellt. Da es etliche Wurzeln und Verstärker der Aggression gibt, wird die ohnehin selbstwidersprüchliche Argumentation, die sich einmal pessimistisch äußert, was den Effekt von Gegenwehr betrifft – er sagt, man weiß njcht, was passiert, bishin zur Möglichkeit einer atomaren Eskalation – und einmal optimistisch, bezogen auf die Folgen einer Kapitulation – wir wissen aber auch hier nicht, was passiert – in dem Punkt des Glaubens an den an sich guten Menschen, nicht gestärkt.
Müller entscheidet zudem über die Köpfe der Ukrainer hinweg, die sich im Vorfeld auf Formen des passiven Widerstandes hätten einstellen sollen, sich jetzt aber fügen sollten. Eine junge Frau aus der Ukraine, die vor dem Krieg in ihrer Heimat fliehen musste und die darüber hinaus auch noch politisch gebildet ist, sagte mir: ‚Ich bin da geboren, sehe es nicht ein, dass meine Heimatstadt einfach okkupiert wird und zudem ist es auch noch völkerrechtswidrig.‘ Das ist keine Kleinigkeit, sondern ein erheblicher Punkt und das Argument, Gebiete einfach abzutreten, wenn sie doch nun mal so begehrt sind, hieße das Völkerrecht zu missachten.
Das Argument, dass es letztlich doch zu einem Einsatz von Atomwaffen kommen könnte, ist eine berechtigte Sorge, aber wenn sie einen Freifahrtschein für Aggressoren mit diesen Waffen darstellt, was wäre das für ein Signal, gerade wenn man Pazifist ist?
Unsere Werte: Welche eigentlich?
Es wäre schön, wenn Frieden wäre, von mir aus lieber gestern als heute. Aber lassen unsere Werte es wirklich zu unausgesetzt wegzuschauen? Warum sollen uns die anderen auf einmal interessieren, das haben sie doch noch nie getan, wäre die Ausformulierung der zynischen Variante, dass Werte zwar irgendwie toll sind, aber wenn es hart auch hart kommt, dann doch nicht so wichtig.
Wir wissen oft gar nicht, was uns im Westen ausmacht, was unser Erbe für die Welt ist, in sehr vielen Jahrhunderten erkämpft. Es ist der Wert des Individuums. Jeder Mensch, jedes Leben, jedes Schicksal zählt und ist nicht zahlenmäßig aufzuwiegen. Das ist der Kerngedanke der westlichen Wertehemisphäre. In anderen Systemen herrscht die Idee vor, dass der Einzelne sich einzufügen und im Zweifel zu Wohl des Staates, des Ganzen, der Gemeinschaft zu opfern habe, das dem Individuum stets übergeordnet ist.
Wer das wirklich verstanden hat, kann dem Einzelnen nie mehr sein Recht auf Selbstbestimmung zugunsten einer größeren Zahl absprechen. Damit geht für das Individuum die Verpflichtung einher dieses Recht verantwortlich zu leben, die eigene Freiheit endet, sagt man gerne, an der Stelle, wo sie an die Freiheit des anderen stößt. Das erscheint mir prinzipiell richtig, wie die Vorstellungen und Werte zu gewichten sind, wird im Einzelfall, im Spiel des Gebens und Verlangens von Gründen ausdiskutiert.
Das begründet seinerseits die Notwendigkeit der freien Rede, für jeden Menschen. Es ist sicher insgesamt zu pathetisch zu behaupten, die Ukrainer kämpften für unsere Werte, weil die Motive und Einstellungen der Menschen aus der Ukraine genauso heterogen sind, wie die anderer Staaten, aber dieses Motiv ist auch eines für den Kampf und sie sind bereit für diese Werte buchstäblich mit allem einzustehen.
Nie wieder! Das ist Teil unserer politischen DNA und ein Motiv der Pazifisten. Erkennen wir früh genug, wenn wir oder andere in die Nähe dieses ‚Nie wieder!‘ kommen?
Warum eigentlich jetzt auf einmal?
Die Feststellung, dass man bei den Russen genau hinschaut, bei den Eroberungsversuchen der Amerikaner oder dem Westen genehmer Regime die Augen gerne mal zukneift, ist ein Punkt, den man anerkennen muss, aber auch in seiner ideologischen Unauflösbarkeit, besonders für uns Deutsche, von denen etwa 75% westlich und 25% östlich geprägt sind.
Dementsprechend kann man die Frage stellen, die sich implizit auch schon bei der Coronapandemie stellte: Warum eigentlich jetzt auf einmal? Warum ist uns das Überleben des Einzelnen auf einmal so wichtig, auch wenn er schon älter ist und warum ist uns die Freiheit anderen auf einmal so wichtig, sie sind doch weit genug weg?
Vielleicht gibt es keinen Grund, zumindest nicht den einen, aber ich finde es gut, dass wir unsere westlichen Grundwerte wieder erinnern, diskutieren und mit alle Konsequenzen einfordern. Sofern das kein Akt der Willkür und Doppelmoral ist, es gilt also auch in Zukunft und in alle Richtungen genau hinzuschauen. Ein wenig könnte ein Revival an die vergessenen Werte anknüpfen, die im Zuge des allgemeinen Funktionalismus nach und nach unter die Räder gekommen sind. Jeder Mensch zählt und hat einen Selbstzweck, das war Kants Meilenstein in unserer Kultur und Europas Geschenk an die Menschheit.
Dies mit den großartigen Weisheitslehren des Ostens zu verbinden ist einer der kommenden Schritte. So weit sind wir noch nicht, doch es gibt Pioniere die uns diesen Weg weisen. Aktuell ist aber Krieg in Europa, ein Krieg der Waffen und ein Krieg der Werte. Der der Waffen sollte schnell beendet werden, auf dem der Werte sollte man wieder wechselseitig lernbereit werden. Eine Autonomie Europas und eine kooperative Weiterentwicklung ist schon in unserem ureigensten Sinn wichtig.
Wo Pazifisten richtig liegen, ist meiner Meinung nach, dass Krieg sich in unserer Welt unterm Strich wirklich nicht mehr lohnt, da in einer zunehmend fragiler werdenden Welt die Kosten für alle in irrationale Höhen getrieben werden.
Quellen:
- [1] Pazifismus in Zeiten des Krieges – Olaf Müller, WDR 5 Neugier genügt – Redezeit. 17.01.2023. 25:11 Min.. https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/neugier-genuegt/redezeit-olaf-mueller-100.html
- [2] Otto F. Kernberg, Liebe und Aggression, Schattauer 2014, S. 301


