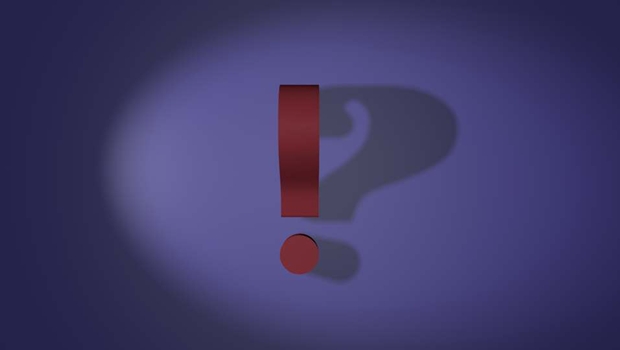Wenn wir, wie angekündigt, das Bild erheblich korrigieren wollen, ist es an erster Stelle wichtig, zu verstehen, dass es nicht zwei Positionen gibt, die sich unversöhnlich gegenüberstehen, sondern drei: Determinismus, Libertarismus und Kompatibilismus.
Die empirischen Daten
Determinist zu sein bedeutet, die Einstellung zu vertreten, festgelegt zu sein. Das klingt eindeutiger als es ist und stellt daher eine Quelle von Verwirrung dar. Die Deterministen im Streit um die Willensfreiheit beziehen sich häufig auf neurobiologische Daten, abgeleitet aus bildgebenden Verfahren. Der Hirnforscher Wolf Singer bringt es paradigmatisch auf den Punkt: „Verschaltungen legen uns fest.“ Wir können nicht anders, als unser Gehirn es zulässt.

Einige Hirnforscher meinen, dass unsere Verschaltungen uns festlegen © Adrian Sampson under cc
Auf den ersten Blick ist das plausibel. Wer kann schon anders, als sein zentrales Bewusstseinsorgan es zulässt? Auf den zweiten Blick muss man sich fragen, ob unser Gehirn eigentlich der Dreh- und Angelpunkt der Welt ist? Ist die Welt samt ihrer Bewohner nur ein Produkt meines Denkens oder gar eine Täuschung? Diese Frage beschäftigte schon den Philosophen René Descartes und rückte das Ich, sein Denken und seine Möglichkeit zu zweifeln ins Zentrum der Welt.
Das Problem dieses Standpunktes ist ein sich daraus ergebender Dualismus, eine unüberbrückbare Spaltung, zwischen geistiger und materieller Welt. Eine Position, die sich philosophisch als nicht haltbar erwies.
Diese kritisieren die Hirnforscher auf der einen Seite zu Recht, auf der anderen Seite, laufen sie ihr, oft wohl ohne es selbst zu erkennen, ins offene Messer. Ihrem eigenen Anspruch nach möchten sie diesen Graben dadurch überwinden, dass sie allem, was nicht „empirisch“ ist, mehr oder weniger die Existenz absprechen. Typisch hier, Gerhard Roth: „Da aus der Dritten-Person-Perspektive eine Entscheidung getroffen wurde und nicht das Ich entschieden hat, kann es nur das Gehirn sein – ein weiterer „Akteur“ ist nicht in Sicht!“ (vgl. „Hirnforschung und Willensfreiheit: Zur Deutung der neuesten Experimente“ S. 77) Damit ist dem Ich nicht nur der freie Wille entzogen, sondern es wurde so nebenbei auch gleich mit aufgelöst.
Alles was jetzt noch zählt, ist das Gehirn und die Daten, die man von ihm ermittelt. Und so gelangt man zu einem Determinismus, der die Auffassung vertritt, was uns ausmacht seien Hirnfunktionen und am besten über die objektivierende Darstellung dieser zu beschreiben.
Diese Sichtweise soll hier nur vorgestellt werden, später wird sie kritisiert.
Harter oder weicher Determinismus?
Doch auch die Gegner eines Determinismus, der besagt, dass unsere Biologie uns festlegt, müssen anerkennen, dass unsere Welt eine geordnete ist, nicht vollkommen willkürlich und zufällig verläuft, sondern gesetzmäßig. So lauten die Spielregeln, auf die man sich in diesem Diskurs geeinigt hat, dass alles mit rechten Dingen zugeht und die Naturgesetze gelten, keine Zauberei möglich ist. (vgl. „Hirnforschung und Willensfreiheit: Zur Deutung der neuesten Experimente“ S. 19)
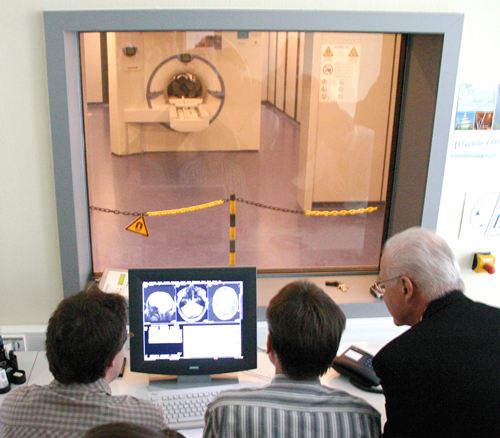
Hirnforscher bei der Arbeit am MRT © Siemens-Pressebild Presselizenz
Dies wird insbesondere in der Auseinandersetzung mit den Kompatibilisten bedeutsam, die gerne, aber falsch, als weiche Deterministen bezeichnet werden. Letztlich ist der Determinismus der Kompatibilisten mindestens so hart, wie der der Neurobiologen, sie kommen nur zu anderen Schlüssen.
Libertarier
Konträr zu den neurobiologischen Deterministen behaupten Libertarier, dass wir nicht ganz und gar festgelegt seien. In der scharfen Form behaupten sie sogar, der Mensch sei in der Lage, vollkommen frei und ungehindert von äußeren Einflüssen, seine Entscheidungen zu treffen.
Doch, wie geht das? Stehen einige Menschen außerhalb der Naturgesetzte? Schwer vorstellbar. Aber auch die sanftere Variante kann nicht befriedigend erklären, inwieweit denn nun ein Zugewinn an Indeterminiertheit, also Willkür oder Zufall, in der Lage ist, die Freiheit zu vergrößern.
Inkompatibilismus
Den neurobiologischen Determinismus und Libertarismus trennt, dass ersterer meint, wir wären voll und ganz determiniert und daher unfrei. Letzterer ist der Auffassung wir seien nicht, zumindest nicht vollständig, determiniert und daraus ergebe sich die Möglichkeit der Willensfreiheit.
So grundverschieden die Einstellungen auch sind, beide eint die Meinung, dass Determinismus und Willensfreiheit unüberbrückbare Gegensätze darstellen – entweder, oder. Diese Ansicht, dass Willensfreiheit und Determinismus nicht zu vereinbaren seien, nennt man Inkompatibilismus.
Doch es gibt noch eine weitere, landläufig viel zu wenig beachtete Position, die beiden inkompatibilistischen gegenübersteht: Den Kompatibilismus. Ihm widmen wir uns in der nächsten Folge.