Eine entscheidende Wende beim Sterben
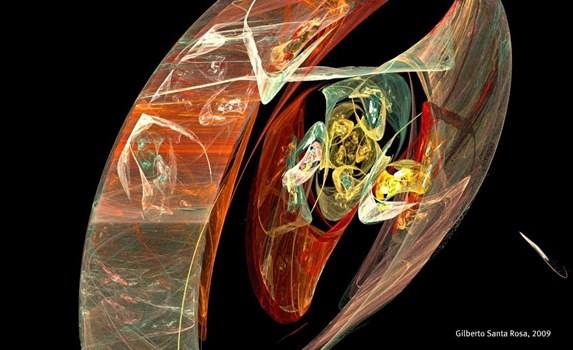
Wir wissen nicht, was uns nach dem Tod oder im Umfeld um das Sterben erwartet. © SantaRosa OLD SKOOL under cc
Menschen, die mit Sterbenden arbeiten, aber auch Sterbende selbst machen oft Erfahrungen großer Klarheit beim Rückblick auf ihr Leben. Das muss durchaus nicht immer traurig sein, auch wenn es große und anrührende Momente sind. Ich habe hin und wieder auch Kontakt zu Sterbenden und kann diese Erfahrung bestätigen: Wenn Sterbende sich erinnern oder sagen, was sie eigentlich noch vorgehabt hätten, was nun aber nicht mehr geht, geschieht das oft ohne Verbitterung. Eine milde Trauer, ein Bedauern ist zu spüren, wenn die nächste Chemotherapie zwar noch geplant ist, aber der Betroffene schon mit leiser Wehmut in der Vergangenheit spricht, oft von ganz einfachen Dingen des Lebens: „Dicke Bohnen, das war was … .“, sagte ein final krebskranker Patient mit dem Blick auf den Fernseher. „War“, hier hat jemand innerlich schon abgeschlossen, doch in der Rückschau war gleichzeitig noch einmal die Freude zu sehen, die er empfand, als er sich erinnerte, ein Strahlen überkam sein Gesicht.
Die Lebensbilanz von Sterbenden ist oft klar und nüchtern und wir könnten hier von ihnen lernen. Am Ende des Lebens ist die Botschaft dieser Menschen oft die, dass sie weniger arbeiten und mehr hätten wagen sollen, aber wir hören unseren Sterbenden nicht immer zu oder setzen ihre Erkenntnisse nicht um. Viele Illusionen, die man sich machte und wohl auch machen wollte, auch dann noch, als schon längst klar war, dass das Leben irgendwie anders läuft, als es mal geplant war, zerfallen wenn der Tod naht. Wohl auch deshalb wird in einem spirituellen Kontext oft die Zeit des Sterbens als besondere Zeit angesehen und auch Martin Heidegger (der freilich vom östlichen Denken beeinflusst war) sieht das Dasein wesentlich als ein Sein zum Tode an.
Eine entscheidende Wende bei Sterbenden ist, dass sie in einem bis dahin kaum gekannten Maß ihre Egozentrik verlieren und sich darum sorgen, wie es mit den Liebsten oder der Welt weiter geht, von der sie demnächst abtreten. Das Ich spielt in den aller meisten Fällen keine große Rolle mehr, wenn man sich bewusst wird, dass das Leben immer ein Geschenk war und ist.
Von einer sterbenden Mutter mehrerer Kinder ist mir bekannt, dass sie gezielt immer wieder auch einzeln und allein Zeit mit ihren Kindern verbrachte, um ihnen als einzelner Mensch (und nicht als „die Kinder“) gerade auch auch im Angesicht des Todes gerecht zu werden. Denn beide Seite profitieren von der Begegnung. Der Dienst am Sterbenden, sagt der Mediziner und Bioethiker Giovanni Maio, wendet sich am Ende zu einem Dienst des Sterbenden und so zu einem wechselseitigen Dienst am anderen.[2] Es mögen vielleicht nur Momente sein, in denen das gelingt, aber was am Ende des Lebens bleibt und zählt, sind Momente. Die wenigen bedeutenden Momente, die wir eingesammelt haben, für die es sich gelohnt hat zu leben.
Gegenüber Kindern sollte man so authentisch bleiben, wie man es ihm Leben auch sein sollte und ihnen die eigenen Gefühle zumuten, auch die schwierigen. „Es ist genug jetzt“, könnte so ein Gedanke eines schwer kranken Menschen sein, aber auch ein: „Ich wäre gerne noch länger geblieben und hätte dich aufwachsen sehen“, kann es sein. Auch der Partner des Sterbenden sollte über seine Gefühle reden, falls das gelingt und man überhaupt weiß, was man in dieser Situation fühlt. Es macht Sinn sich den Kindern gegenüber so zu benehmen, wie man es sonst auch tut und sie in den Sterbeprozess mit einzubeziehen, damit auch sie Abschied nehmen können und nicht darüber phantasieren müssen, was passiert ist.
Rituale erleichtern den Abschied
Rituale markieren oft den Übergang von einem Lebensabschnitt in einen anderen. Geburt, Hochzeit und eben auch der Tod werden bei uns noch rituell begleitet. Der sterbende Vater oder die sterbende Mutter verlässt dann die Gemeinschaft und wird beerdigt oder verbrannt. Die Vorstellung, was danach geschieht, ob überhaupt noch etwas geschieht oder ob alles vorbei ist, ist abhängig vom Glauben, in den jemand eingebunden ist und davon, wie stark jemand tatsächlich glaubt. Doch für die aller meisten Menschen, ist ein Ritual eine äußere und konkrete Begleitung einer inneren Wandlung, in dem Fall einer Wandlung zu einem Leben, das nun ohne den Verstorbenen weiter geht.
So kann man auch den Umgang mit der Leiche vor der Bestattung noch einmal neu überdenken, Carmen Thomas hat darüber ein schönes Buch mit dem Titel „Berührungsängste? Vom Umgang mit der Leiche“ geschrieben. Doch als Faustregel scheint mir richtig zu sein, auch diesen Moment nicht künstlich zu überfrachten, sondern grob gesagt so zu sterben, wie man gelebt hat.
Das Kind
Für das Kind ist der Tod eines Elternteils so gut wie immer traumatisierend. Gut wäre es, den Weg zu finden, mit dem das Kind kreativ selbst am besten umgehen kann, auch mit der Ambivalenz seiner eigenen Gefühle. Denn neben der fraglosen Trauer, gibt es weitere Emotionen, wie Wut auf den Verstorbenen, die ohnmächtige Wut, des: „Wie kannst du mich (ausgerechnet jetzt) verlassen?“ Dem Kind das Sterben oder den Anblick der Leiche völlig zu ersparen, ist vielleicht gut gemeint, aber oft nicht sinnvoll, weil gerade kleine Kinder dazu neigen darüber zu phantasieren, dass jemand doch noch lebt, wenn sie nicht sehen, dass er gestorben ist und man Kindern in früheren Zeiten und anderen Kulturen noch heute die Tod ganz selbstverständlich zumutete und damit auch zutraute, ihn zu verarbeiten.
Wie nah sollen Kinder den Tod des Elternteils erleben?
Es sind nicht unbedingt die schlimmen Bilder der Verfalls, der Schläuche, Kabel und Apparate oder der Anblick der Leiche, der den Kindern zusetzt, es ist eher der Verlust und die Abwesenheit des Elternteils. Wenn die Kinder klein sind und Zeugen einer chronischen oder schweren und fortschreitenden Erkrankung sind, dann kennen sie das eine Elternteil oft gar nicht anders als krank. Für Kinder ist das schnell Normalität, weil sie in jungen Jahren noch keine Vergleichsmöglichkeiten haben und sich zudem schnell anpassen können.
Auch emotional profitieren Kinder vermutlich meistens davon, wenn man ihnen nicht zu viel, vermeintlich wohlmeinend, erspart. Es macht in meinen Augen Sinn, Kinder – dem Charakter des Kindes und altersangemessen – die eigenen Gefühle des Sterbenden und des Partners miterleben und ihre eigenen äußern zu lassen. Das ist bei neurodegenerativen Erkrankungen vielleicht schwieriger, bei denen es am Ende zu schweren charakterlichen Veränderungen kommen kann, bei Krebserkrankungen ist man aber in aller Regel psychisch klar, auch wenn die Emotionen je nach Tagesform wechseln, wie das für Emotionen eben normal ist.
Man muss mit Kindern keine tiefen Diskussionen führen, aber man kann ihnen die eigene Ängste und Unsicherheiten im Bezug auf den Tod und das Sterben, aber auch die Sorge um ihre weitere Zukunft ebenso mitteilen, wie vielleicht Momente der Klarheit, der Schönheit und Ergriffenheite, der Erinnerung, die eben auch zum Leben eines Schwerkranken gehören, der nun auf einmal viel Zeit zum Nachdenken und Reflektieren hat, eine Zeit, die wir uns vorher selten nehmen. Das Kind hat die Chance den Menschen hinter dem Kranken noch einmal kennen zu lernen, auf eine ganz andere und vielleicht nicht mal schlechtere, weil präsentere Art, als im Alltag, wo es vielfach darum geht, zu funktionieren.
Authentisch zu bleiben und den eigenen Kindern etwas zuzutrauen, ist also eine gute Voraussetzung, im Leben, wie auch an der Schwelle zum Tod. Insofern sollte man auch ansprechen, dass man (höchstwahrscheinlich) sterben wird und dann für das Kind, nicht mehr da sein kann. Es kann auch offen darüber geredet werden, dass man dem Kind oder den Kindern vielleicht etwas hinterlassen möchte, was das sein und wie man das machen könnte, dazu am Ende des Beitrags mehr. Dem Kind neben den starken Seiten auch die schwachen zu zeigen, heißt auch, zu starken Idealisierungen vorzubeugen und die eine menschliche Seite hinter der immer auch etwas einsetigen Fassade des Kranken zu sehen.


