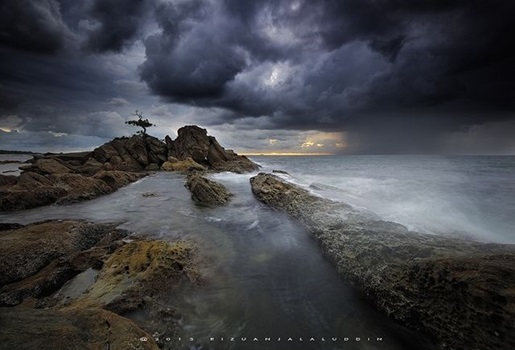Die Polarität, manchmal auch Dualität oder Dichotomie, ist ein modellhafter Versuch die Welt zu begreifen. Den Begriff der Polarität kennt man aus Natur- und Gesellschaftswisssenschaften, Philosophie, Psychologie, Religion bis hin in die Esoterik, die den Begriff popularisierte. Bei Wikipedia heißt es:
„Polarität ist ein Ausdruck der Philosophie für das Verhältnis sich gegenseitig bedingender Größen. Sie unterscheidet sich vom Dualismus, bei dem die Größen als antagonistisch (nicht miteinander vereinbar) gesehen werden. Bei der Polarität geht es nicht um einen unvereinbaren Gegensatz, sondern um ein komplementäres Verhältnis.
Eine Polarität besteht aus einem Gegensatzpaar und der Beziehung zwischen den Polen: hell – dunkel, kalt – heiß, schwarz – weiß, Mann – Frau, Liebe – Hass, arm – reich, krank – gesund usw., wobei einem einzelnen Pol nie eine Wertung (etwa gut oder schlecht) zukommt. Die Pole sind die zwei gegenüberliegenden Enden derselben Sache, untrennbar zu einer Einheit verbunden und bedingen einander. Tag lässt sich nur im Kontrast zur Nacht definieren, Heiß nur, wenn es auch Kalt gibt, keine Armut ohne Reichtum etc.“[1]
Eine der zentralen Fragen ist die, ob nun die Welt tatsächlich polar ist (das wäre eine ontologische Frage; Ontologie = Lehre vom Sein; wie es ist) oder wir sie nur so begreifen und uns erschließen können (eine epistemologische/erkenntnistheoretische Frage; in etwa die Frage, wie uns etwas erscheint und warum es uns so erscheint). Und natürlich, was es uns bringen soll, die Welt so, als Polarität, oder ganz anders zu begreifen.
Polarität und Pluralität
Bei uns hat sich eine etwas andere Sicht auf die Welt eingebürgert, nämlich die, dass Weltgeschehen nicht auf simple Polaritäten zu reduzieren sei, sondern alles in allem komplexer verlaufe. Zig Faktoren greifen ineinander, hemmen und verstärken sich gegenseitig, über die man am Ende dann meist nicht viel mehr sagen kann, als dass sie sehr komplex sind und dass bereits winzige Veränderungen (mindestens der Anfangsbedingungen) riesige Auswirkungen haben können.
Das bringt uns ein wenig in eine Position des ohnmächtigen Beobachters, der paradoxerweise ohnmächtig ist, weil er so viel weiß. Und im Grunde nur sagen kann, dass das irgendwie alles sehr komplex ist und dass man Supercomputer hätte, die all die Daten berechnen, aber wir wissen inzwischen, dass man sich auch da nicht so ganz sicher sein kann, weil die Rechenkraft zwar enorm ist, aber das Ergebnis oft eben auch nur so gut, wie die Komponenten die man hineinsteckte und hierarchisch gewichtete. Und das ist noch immer mehr oder minder willkürlich.
Wir haben es aber nicht so gerne, wenn man uns sagt, dass wir es eigentlich auch nicht so genau wissen, zumal zu den Versprechungen unseres wissenschaftlichen Zeitalters gehört, dass wir die Probleme die es gibt, alle verstehen und lösen können. Eine Idee ist dabei auch, dass Komplexität irgendwie stabiler und funktionaler ist, als simples.
Auf der gesellschaftlichen Ebene machen wir allerdings aktuell andere Erfahrungen. Komplexere Systeme kommen zunehmend in Schwierigkeiten und es profitieren die Vertreter einfacher Botschaften: Fundamentalismus, Populismus und Extremismus haben Aufwind, in Deutschland, Europa, weltweit. An Francis Fukuyamas Thesen vom Ende der Geschichte glaubt man heute nicht mehr und hat eher Angst vor einem Ende der Demokratie. Doch wie kommt das, nach dem alles so rosig aussah? Nun, die pluralistischen Erklärungen lauten, dass das eine sehr komplexe Gemengelage aus zig Faktoren ist und dummerweise kommen ziemlich unterschiedliche bis konträre Lesarten heraus, je nach dem, wie stark man welchen Faktor gewichtet und die Gewichtung ist nicht neutral, sondern eine weltanschauliche, auch wenn natürlich ständig das Gegenteil behauptet wird.
Die Erklärungen der Polarität sind im Grunde gar keine Erklärungen im klassischen Sinne, sondern eher eine Behauptung. Obendrein noch eine herausfordernd einfache Behauptung, die sagt, dass das Pendel hin und damit zielsicher auch wieder zurück schwingt. Dass wir mit anderen Worten in Rhythmusprozesse eingebunden sind, die mal größere und mal kleinere Amplituden haben, aber die im wesentlichen eben ein Rhythmusgeschehen abbilden. Das hat natürlich eine gewisse fatalistische Note, die wir nicht sonderlich schätzen, da wir zumindest gerne in der Illusion leben, dass wir unser Schicksal selbst im Griff haben. Und doch wissen wir nicht, warum nach Jahren der Ausbreitung von Demokratie und Marktwirtschaft, dem Glauben an das Ende der Mythen, Religionen und dem Siegeszug der Rationalität nun auf einmal so ein rapider Wandel eingetreten ist. Aus Sicht einer Weltanschauung die den Wechsel der Pole betont, im Grunde kein Wunder, fast eine Notwendigkeit. Je weiter man im Extrem des einen Pols angekommen ist, umso näher der Tag, an dem das Pendel zurück schwingt.