
Der Wunsch nach immer mehr Perfektion, kann schnell überfordern. © Mike Ownby under cc
Ob es nun eine Ausdruck einer tiefen Polarität oder nur ein Kalenderspruch ist, dass die Extreme sich berühren, oft genug kippt ein heldenhafter Versuch alles im Leben richtig zu machen und das Schlechte des Guten wird offenbar. Was letzten Endes gut oder schlecht ist, ist relativ, man könnte auch sagen: dynamisch. Es muss nicht nur zum Einzelnen, sondern auch zu dessen aktueller Lebenssituation passen. Damit ist im Grunde schon alles gesagt, hinzuzufügen wäre allenfalls noch, dass der Betreffende das nach Möglichkeit noch selbst merken und ansonsten die Augen und Ohren ein wenig offen halten sollte, was wohlmeinend kritische Bemerkungen von Außen angeht.
Aber die Lebensrealität ist heute oft eine andere. Die oftmals turmhohen Ansprüche der Eltern werden früh verinnerlicht, so dass sie zu dem werden, was man als „Ich will das so“ fühlt. Und diese Ansprüche werden als solche oft gar nicht mehr besonders wahrgenommen, weil das Umfeld auch so tickt. Ob brennender Ehrgeiz, die andauernde Warnung, dass die Konkurrenz nicht schläft oder die satte Wucht der Normalität, die uns sagt, dass das eben heute einfach so ist: gar nicht so wenige Menschen sind auf Konkurrenz gebürstet und meinen das nicht mal böse, denn die Welt um sie ist tatsächlich so.
Der Wunsch es gut und richtig zu machen
Und so ist das Motiv, das oft das Schlechte des Guten zum Vorschein bringt, auch kein schlechtes. Man will sein Leben gut und richtig führen, in dieser stets merkwürdigen und individuellen Weise, mit der man versucht fremden und eigenen Ansprüchen, gesellschaftlichen Normen und privaten Vorlieben gleichzeitig gerecht zu werden. Doch da Teile des Außen, seiner Werte und Normen über Internalisierung nach innen dringen und zum eigenen Ich oder Über-Ich werden, spürt man in sich mit der Zeit einen gewissen Druck.
Den Druck in einer Welt zu leben, die etwas kompliziert ist und als Antwort darauf Lösungen präsentiert, die etwas einfach sind. Eine dieser einfachen Antworten lautet: Wenn die Welt wirklich immer ungleicher wird und man schnell abrutschten kann (wenigstens das Gefühl ist in vielen von uns präsent), dann sieh‘ zu, dass du nicht nicht zu den Verlierern gehörst.
Und so strengt man sich an und das ist als Strategie gar nicht schlecht, weil man inzwischen aus zahllosen Büchern und Artikeln weiß, dass Intelligenz nicht alles ist, man mit Fleiß und Disziplin weit kommen kann und das gibt ja immerhin auch Hoffnung, für Menschen, die nicht vor Schönheit, Talent und Intelligenz aus allen Nähten platzen. Aber wenn und weil man meint, dass die Konkurrenz nicht schläft ist es nicht damit getan fleißig zu sein, denn man hört ja immer wieder, wenn man sich umhört und das gehört eben dazu, wenn man vorne dabei sein will, dass man mit vielen jungen Erwachsenen heute nicht viel anfangen kann. In Rekordzeit zum Bachelor durchgestartet, haben sie im Leben wenig gesehen, außer der Schulbank und das soll den eigenen Kindern natürlich nicht passieren.
Und man weiß, dass viele junge Erwachsene etwas linkisch sind, es manchmal schon an den Grundtugenden mangelt und hieran kann man arbeiten. So etwas lernt man in der Tanzschule, beim Reiten oder Sport, oder wenn man früh Praktika macht, gerne auch im Ausland, man mit dem realen Leben konfrontiert wird und so bessert man auch hier nach und verschafft sich und dem Nachwuchs Wettbewerbsvorteile.
Und außerdem ist es ja auch tatsächlich gut, wenn das eigene Kind nicht sozial inkompetent ist, denn auch Teamfähigkeit gehört ja wenigstens offiziell zu den geforderten Eigenschaften, die man haben sollte. Und so verfeinert man sich immer weiter, getrieben von Sorge, hoffentlich manchmal Spaß und oft von Getriebenen.
Und die Eltern?
Viele Eltern, aber auch kinderlose Paare und Singles, haben das Gutseinwollen verinnerlicht. Nicht unbedingt nur noch den Wunsch nach Erfolg, sondern das Leben soll gelingen, man will kein Loser aber auch kein schlechter Mensch sein. Und das eben auch, aber nicht nur karrieretechnisch, denn man weiß, heute zählen, neben dem was inzwischen die meisten drauf haben und was deshalb auch schon wieder out ist, auch die Soft Skills immer mehr.
Und auch da will man nicht außen vor sein, weder die Kinder, noch man selbst, Frau auch nicht. Und so ist der nicht so ganz leicht einlösbare Wunsch in der Welt Supergirl zu sein. Die Stellschraube sind Ernährung, die neue Wunderdiät, Folge 282 und Bewegung, Fitness. Die Top Figur direkt nach der Geburt des einen Kindes, ein „must have“, wird mit Disziplin, Power Yoga und Hormon Yoga erhalten, effektive Entspannung inklusive, daneben auch soziale Kompetenz und ein Interesse für die Welt, aber genau so läuft es nicht, denn ein Interesse an anderen kann nicht im Dienste des Egoismus stehen und dem Wunsch, immer perfekter werden zu wollen. Aber das interessiert nur die eine große Gruppe der Gesellschaft, der anderen ist und kann das egal sein.
Ist es für die Frauen schon aufreibend Supergirl zu werden so hat man doch zuweilen den Eindruck, dass die Männer die tragischeren Figuren in dem Spiel sind. Bei ihnen vor allem deswegen, weil die Erfüllung des von allem etwas Ideals so schwierig ist: oben Vollbart, unten rasiert und mit Waschbrettbauch, dazu die nerdig großrandige Brille, aber voll der liebe Papa und Familienmensch, der dennoch selbstbewusst ist, im Beruf ebenso seinen Mann steht, wie beim Sex und den das irgendwie doch noch Wilde, wenn es gefordert wird auch noch umweht, wenn er die fettarme Hähnchenbrust mit Zucchinischreiben grillt und perfekt im unteranderthalbtausendeurogehtgarnix Grill zubereitet und von den beeindruckten Besuchern Bestnoten für Performance und Geschmack erhält. Wild und manierlich, perfekt kredenzt, in der legeren, aber stylischen Safarihose, mit Taschen über den gut gebräunte, bemuskelten und rasierten Beinen. Wow, oder auch ein Typ, der auf dem besten Weg ist, seine eigene Karikatur zu werden. Der Weg der Selbstoptimierung kann aber in zwei Richtungen gehen und die eine ist dabei durchaus diese:
Endlich ist die Welt so, wie ich sie mir immer gewünscht habe
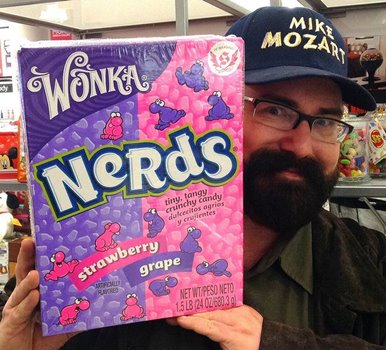
An der Grenze von Werbung und Leben. So süß kann’s gehen, oder: Heute schon ironisch gebrochen? © Mike Mozart under cc
Man kann sich in diesem Lebensgefühl durchaus gefallen und gerade, wenn man jung ist hat man das Gefühl „Yeah, wir sind’s!“ und das kann schön und erhebend sein und über etliche Jahre tragen. Ob das nur eine Masche oder Marke ist, kann einem in dem Moment egal sein, wo man dieses Lebensgefühl ganz in sich aufgesogen hat und authentisch lebt. Das ist ironiefrei gemeint und auch völlig in Ordnung.
Ziel einer guten Psychotherapie ist es, den Menschen zu sich und seinen Bedürfnissen zu führen und die können durchaus mit dem, was die Werbung anzubieten hat konform gehen. Wenn das noch gut vermarktet wird – und das wird es – hat man nicht das Gefühl ferngesteuert zu sein, sondern mitten drin, im Leben. Und es ist gut, wenn Menschen das Gefühl haben, im Leben angekommen zu sein, statistisch ist es ganz einfach so, dass die Mehrheit der Menschen im Mainstream (Hauptstrom) ankommen wird, denn der ist dadurch definiert, dass er die Mehrheit ist.
Selbst wenn man in einigen Bereichen von diesem Mainstream abweicht und sich nicht mit ihm identifizieren möchte, ist es bei der Vielzahl der Menschen so, dass sie in anderen Bereichen auch im Mainstream verwurzelt sind, oft aber eine Abneigung dagegen haben, weil Mainstream, Masse und Durchschnitt negativ besetzte Begriffe sind.
Weiterhin muss man sagen, dass es ein Übergriff ist, wenn man versucht, Menschen, die dort mit dem größeren Teil ihres gesamten Soseins verwurzelt sind, aus dieser Verwurzelung zu „befreien“. Das kann für einen Teil richtig sein, ein anderer Teil wird dadurch eher überfordert und verunsichert.
Ich komm‘ da nicht mehr raus
Denn da nicht mehr raus zu kommen, ist das Empfinden des anderen Teils einer großen, aber in sich gespaltenen Mehrheit. Sie suchen ihr Glück auf demselben Weg, finden es aber nicht. Und damit sind nicht jene gemeint, denen es nicht gelingt die stillen Vorgaben zu erfüllen, sondern diejenigen, denen das sehr wohl gelingt, deren Glücksgefühle oder mindestens satte Zufriedenheit sich aber irgendwie nicht einstellen will. Im Grunde wissen sie, wie es geht, optimieren und nachbessern. Aus Fehlern lernen, weiter, weiter, immer weiter, nicht die Zuversicht verlieren.
Doch für eine vermutete Minderheit der großen Mitte wird diese Selbstsuggestion irgendwann schal und das ist gut so. Zweifel kommen auf, an der gesamten Linie. Die Zweifel sind berechtigt, weil genau so eine Immunisierung gegen Kritik funktioniert. Zu deutsch bedeutet das: Wenn du mit dem eingeschlagenen Weg keinen Erfolg hast, liegt es an dir. Du hast dich halt nicht genug angestrengt und die Lösung lautet: mehr optimieren, weiterer Feinschliff, alles aus sich herausholen.
Doch es gibt Menschen, die das richtig gut machen und deren Zweifel dennoch immer mehr wachsen: Ist das mein Leben? Da muss es mehr geben, das kann nicht alles sein. Ist es auch nicht. Es ist der Geburtsschmerz, mit dem das reflexive Ich allmählich erwacht. Wir sind hier an einer spannenden Stelle an der man zeigen kann, wie Entwicklung weiter geht oder warum sie ins Stocken gerät. Ein Grund ist, dass die Sichtweise oder Entwicklungsstufe, über die wir hier reden äußerst häufig ist. Die meisten Menschen bewegen sich in und um diesen Bereich und die Augen, aus denen man blickt, sieht man nicht.
Das unbewohnte Haus, oder: Der Unterschied zwischen Nachdenken und Reflexion
Was das Ich ist, ist nicht so leicht zu sagen, weil es das „Ich“, als ein festes, die Zeiten überdauerndes Etwas nicht gibt. Das Ich wechselt ständig seinen Charakter und wird dabei im besten Fall immer umfassender und komplexer. Relativ früh beginnt das Ich über seine Welt nachzudenken. Darüber, wie das alles funktioniert. Im besten Fall, ist es ein neugieriges Ich, das alles aufsaugt und mit Lust lernt und über das Gelernte nachdenkt, in Beziehung setzt. Und das ist jede Menge: Nicht nur das, was man in der Schule ganz klassisch und oft mit Mühe lernt, sondern auch all das, was man so nebenher mitnimmt. Wie man sich im Internet bewegt, der eigene Körper funktioniert, ebenso die Familie, Freunde und Haustiere, dass Erwachsene anders sind als Kinder und so vieles mehr, was man an impliziten oder expliziten Regeln lernt.
Zwei Dinge werden in den jungen und so lernintensiven Jahren zumeist ausgespart, nämlich das Nachdenken über sich selbst und die eigene Sicht auf die Welt. Man könnte auf den ersten Blick meinen, weil sie die selbstverständlichsten Aspekte der Welt seien, wen oder was kennt man schließlich besser als sich selbst und die eigene Sicht aufs Leben?
Ja, sollte man meinen. Tatsächlich aber, ist es anders. Schon Freud stellte fest, dass das Unbewusste nicht nur jenen Bereich meint, der irgendwie in früher Kindheit liegt und vergessen oder verdrängt wurde, sondern merkwürdiger Weise auch jenen, aus dem heraus man gerade agiert. Das heißt, ich funktioniere, agiere, denke, fühle und lebe gerade auf eine bestimmte Art und Weise, weiß aber eigentlich nicht wie und warum.
Ich weiß vielleicht, was ich will und wie ich an mein Ziel komme, alleine oder mit der Hilfe anderer, kann sehr intelligent und geschickt sein, sogar wissen, wie ich andere dazu kriegen kann, mich und meine Ziele zu unterstützen und noch jede Menge mehr, doch es kann gut sein, dass ich bei all dem nicht weiß, wieso ich das eigentlich will. Man kann zentnerweise Wissen angehäuft haben und sehr intelligent sein und doch diese beiden Dinge nicht sehen: Wie und warum ich eigentlich bin, wie ich bin und wie und warum ich die Welt so sehe, wie ich sie sehe.
Das nicht sehen zu können, ist keine Dummheit. Man sitzt sozusagen die ganze Zeit am Fenster eines Hauses, betrachtet die Umgebung, sieht viel, in dieser Umgebung, nur dass man selbst in einem Haus sitzt und aus dem Fenster schaut, das sieht man nicht. Genau so, wie man das eigene Gesicht nicht sieht, wenn man nicht den Umweg über das Außen nimmt. Man braucht einen Spiegel oder muss das Haus verlassen. Auf der physischen Ebene ist das recht leicht, auf der psychischen weitaus schwieriger, weil es nicht reicht, mal eben hinzuschauen. Streng genommen ist es auf der physischen Ebene auch nicht so leicht, denn wenn wir in einen Spiegel schauen, besteht der wesentliche Schritt darin, zu begreifen, dass das was wir da sehen, wir selbst sind und nicht ein anderer. Manche Tiere und kleine Kinder schaffen diesen Bewusstseinsschritt noch nicht, für uns ist er ein Klacks und wir denken darüber nicht mal mehr nach.
Geistige Reflexion ist schon sprachlich verwandt mit dem Spiegelvorgang und leitet die Gedanken immer wieder auf den Denkenden zurück, versucht ihn, der da aus dem Fenster in die Landschaft oder in den Spiegel schaut, zu erkennen. Wie bin ich eigentlich? Warum bin ich so und nicht anders? Hätte mein Leben auch anders verlaufen können oder kann ich ihm eine andere Richtung geben? Zweifel daran, dass das alles so weitergehen muss wie bisher keimen auf. Wir vertiefen das.
Worin liegt das Schlechte des Guten?
Die Zweifel sind die Stimme der aufkeimenden Reflexion. Man stellt sich vor, wie es auch sein könnte, jenseits des Weges, der irgendwie die ganze Zeit vorgezeichnet schien. Wenn der Weg vorgezeichnet ist, ist das durchaus nicht immer ein Nachteil, denn man weiß früh, wo man hin will, welche Rolle man in der Welt spielen spielen soll.
Der Nachteil ist, dass das Leben dann fremdbestimmt ist. Wenn die Eltern ein gut gehendes Geschäft haben, steht oft fest, dass der Sohn oder die Tochter es mal übernehmen werden. Weil dies ja auch irgendwie vernünftig, gut laufend und etabliert und außerdem Familientradition ist. Oft war das stille oder offene Erwartung, über die gar nicht mehr groß diskutiert wurde: „Wenn du dann mal den Laden übernimmst … .“ So werden Fakten geschaffen.
Ob auf diese oder subtilere Weise, man verliert seine reflexive Individualität oder genauer, gelangt nicht an den Punkt, an dem man diese aufbauen kann. Man erfüllt äußere Vorgaben und Erwartungen und böse gesagt, wird man im schlimmsten Fall zur perfekten Stangenware. Genau so, wie anderen, Eltern, „die Gesellschaft“ oder die Werbeindustrie einen haben wollte.
Die perfekte Kombination ist, eine Marionette zu schaffen, die von sich denkt, sie sei frei und von anderen, dass sie alle manipulierte Schafe seien. Wenn man diese Idee einmal geschluckt hat, ist sie so leicht nicht mehr aus dem Kopf zu kriegen, schon allein deshalb, weil es sehr viele Menschen gibt, die so denken und es die vermutlich bei uns am weitesten verbreitete Entwicklungsstufe ist, die mythisch-rationale.
Nun ist die Geschichte um diesen Entwicklungsdrehpunkt aber alles andere als einfach und hat mehrere Haken. Zunächst der relativ offensichtliche: Wenn die Bahn des Lebens vorgezeichnet ist, ist es meine höchste Aufgabe in diese Rolle zu schlüpfen, gelingt das nicht, ist es mein Fehler. Ich habe mich einfach nicht genug angestrengt oder bin nicht klug oder talentiert genug. Daraus resultiert eine tiefsitzende Überzeugung: Ich darf keine Fehler machen.
Das mal nicht nur im narzisstischen Sinne, denn der damit oft einhergehende Perfektionismus hat zwei Arme, näheres in: Perfektionismus. Dieser Perfektionismus nagt und geht oft mit Kontrollzwängen einher. „Hab‘ ich auch alles richtig gemacht, an alles gedacht, nichts übersehen?“ Ein niederdrückendes Gefühl was oft mit der Angst vor Schuld und Versagen einhergeht. Die Lösung wäre auch hier einfach, man könnte und müsste den Rat geben, einfach und in vielem mal etwas lockerer zu werden. Nur ist damit niemandem geholfen, am wenigsten denen, die an diesen Zwängen leiden.
Doch das ist nur die eine Seite. Das Schlechte des Guten hat noch mehrere andere Aspekte.
Entwicklungsstress
Denn nach diesen Rollen zu leben ist nicht falsch. Es ist für die Menschen richtig, die mit mehr überfordert wären. Nun sind wir zu einem guten Teil so geschaffen oder gedrillt, dass wir hoch hinaus wollen. Wir wollen nicht zu denen gehören, die sagen müssen, dass sie überfordert sind und deshalb nicht mehr mitkommen und lieber wieder in ihrer alte, geordnete, vielleicht etwas enge, aber doch sichere und überschaubare Welt zurück wollen. Wobei es wichtig ist, das nicht zu miefig und gestrig zu denken. Es geht nicht um die Rollenbilder von 1950, sondern von 2017. Das Haus in dem man sitzt, aus dessen Fenster man in die Welt blickt und aufrichtig sagt: Tut mir leid, ein Haus sehe ich nicht.
Der bärtige Jungpapa mit der nerdigen Brille, dem Vollbart und der rasierten Brust, der ganz natürlich macht, was er möchte und sich gut dabei fühlt. Weil er vielleicht noch einen Job hat, mit dem er happy ist, eine Frau, die er liebt und mit der es gut läuft und sich einfach, bei allem Stress, den jeder mal hat, sehr viel nach angekommen und alles richtig gemacht anfühlt: „Yeah, wir sind’s!“ Und mit welchem Recht könnte man diesen Menschen sagen, dass sie mehr wollen müssen? Die Zweifel, ob das alles war oder ist, falls sie kommen – sehr oft kommen sie auch nicht – kommen dann schon von selbst. Warum die schönen Jahre zerstören?
Psychotherapie bedeutet den Menschen zu sich zu führen, aber das kann eben auch sein, dass dieses Ich mit der Rolle, die es spielt vollkommen ausgesöhnt ist und sich prächtig fühlt. Und seinen Platz im Leben gefunden zu haben, ist gut und richtig.
Und aus dem gleichen Grund ist es gar nicht in allen Fällen gut gegen die angebotene Rollen zu opponieren. Der Anzug kann ja perfekt passen. Ob er passt und man sich in ihm wohl fühlt, entscheidet man selbst.
Herauf dämmernde Zweifel

Zuneigung, mal wörtlich. Ersatz für Verpasstes, eigene Welt oder irgendwie beides? Carl Spitzweg, in Wikimedia under gemeinfrei
Der Anzug kann chic sein, aber man kann das Gefühl haben, dass er irgendwie nicht das ist, was ich will. Im ersten Affekt weist man dann oft alles Etablierte und Konventionelle zurück, will so ganz anders sein, alles anders machen, nur wird man dabei oft schnell ausgebremst. Auch weil einem manches, was konventionell und ein Massenprodukt ist, vielleicht sogar gefällt. Es ist anstrengend bis aufreibend in jeder Lebenslage originell sein zu wollen und es ist nur eine weitere Rolle, es zu müssen. Der Tanz um das goldene Kalb, von der anderen Seite.
Gut ist, sich selbstbewusst aus dem großen Angebot Welt zu bedienen und wenn man die Rollenspiele tatsächlich überwunden hat, merkt man das meistens daran, dass man bunt mischt, Konventionelles und Unkonventionelles, Banales und Spezielles, je nach individueller Neigung und nicht länger den Snob gibt.
Ken Wilber weist darauf hin, dass es ein Unterschied ist, das was möglich wäre in feuchten Träumen gelegentlich zu antizipieren oder dieses Stufe zum Bestandteil der eigenen Psyche zu machen und zu etablieren:
„Das Auftauchen der formal-reflexiven Basisstruktur eröffnet die Möglichkeit der D-5-Selbstentwicklung: eine hochdifferenzierte, reflexive und introspektive Selbststrukturierung. Das D-5-Selbst ist nicht mehr unreflektiert an soziale Rollen und konventionelle Moral gebunden; zum ersten Mal kann es sich auf seine eigenen individuellen Prinzipien von Vernunft und Gewissen stützen (Kohlbergs postkonventionelles, Loevingers gewissenhaft-individualistisches Selbst etc.). Zum ersten Mal kann das Selbst eine mögliche (oder hypothetische) Zukunft konzipieren (Piaget) mit ganz neuen Zielen, neuen Möglichkeiten, mit neuen Wünschen (Leben) und neuen Ängsten (Tod). Es kann mögliche Erfolge und Misserfolge abwägen auf eine Art, die es sich zuvor nicht vorstellen konnte. Es kann nachts wachliegen vor Sorge oder Begeisterung über alle seine Möglichkeiten. Es wird Philosoph, ein Träumer im besten und höchsten Sinn; ein innerlich reflexiver Spiegel, staunend über seine eigene Erkenntnis. Cogito, ergo sum.
„Identitätsneurose“ bezeichnet spezifisch alle Dinge, die beim Auftauchen dieser selbstreflexiven Struktur schiefgehen können. Ist sie stark genug um sich von Regel/Rollen-Geist freizumachen und für ihre eigenen Gewissensprinzipien einzustehen? Kann sie, wenn nötig, den Mut fassen, nach einer eigenen Melodie zu marschieren? Wird sie es wagen, selbst zu denken? Wird sie von Angst und Depressionen erfasst angesichts ihrer eigenen Möglichkeiten? Diese Dinge – die leider von vielen Theoretikern der Objektbeziehungen auf die D-2-Dimension von Trennung und Individuation reduziert werden – bilden den Kern des D-5-Selbst und seiner Identitätspathologie. Erikson (1959, 1963) hat die vielleicht definitiven Studien über die D-5-Selbstentwicklung geschrieben („Identitiät vs. Rollenkonfusion“). Hier kann nur die Beobachtung hinzugefügt werden, dass philosophische Probleme ein integraler Bestandteil der D-5-Entwicklung sind und philosophische Erziehung ein integraler und legitimer Bestandteil der Therapie auf dieser Ebene ist.“[1]
Die Philosophie ist auf dieser reflexiven Ebene gleich mit eingepreist und dann machen wir doch da mal weiter.
Die gesellschaftliche Komponente und das ethische Dilemma
Wir leben in einer angespannten Zeit, wie in Verunsicherung oder Weltuntergang bereits thematisiert. Eine irgendwie verständliche Gegenreaktion auf die Verunsicherung, wenn auch zu früh abgebogen, ist der Fundamentalismus. Ein klares Bekenntnis zu bestimmten Werten, die einem Halt und Sicherheit geben. Aber auch das ist nichts für alle und nicht für die Menschen, um die hier geht.
Wie in Besser und schlechter oder nur anders? – Die Entwicklungsstufen der Weltbilder ausgeführt, ist nicht ganz klar, ob Entwicklung nun bedeutet: zum Höheren und irgendwie Besseren oder ob Entwicklung eher immer währende Anpassung an immer neue äußere Bedingungen ist. Favorisiert man die erste Version, dann kann man zu der Idee gelangen, zu der viele Menschen, die sich mit den Themen, Entwicklung, Psyche, Gesellschaft und Umwelt beschäftigt haben, durchaus kamen, dass nämlich an vielen äußeren Problemen, vom Hunger in der Welt, über Kriege bis zur Umweltzerstörung, die Frage nach dem Bewusstsein mindestens einen kräftigen Anteil hat.
Wenn man sich die Situation heute anschaut, dann kommen manche zu der Einschätzung, dass es knapp werden könnte, was das Überleben der Menschheit angeht. Dabei wäre eben vieles en passent zu lösen, wenn nur mehr Menschen entwickelter wären, bewusster und achtsamer lebten. Daraus ergibt sich so etwas wie ein ethischer Imperativ, die Bewusstseinsentwicklung der Menschen etwas zu forcieren, soweit dies möglich ist. Dass es möglich ist und wie, davon ist unter anderem der oben zitierte Ken Wilber überzeugt und mit ihm die integrale Bewegung, mit der der Autor sympathisiert.
Auf der anderen Seite ist dies nicht meine einzige Sympathie und so sehe ich mit Sorge, was Hektik, Perfektionismus und dauernde Überforderung im Leben anrichten und wie wichtig es ist, die Jahre, in denen man meint nun endlich den Dreh gefunden zu haben und mit dem Leben einverstanden ist, zu genießen. Denn so schlicht der Satz: „Wer nicht genießen kann, wird schnell ungenießbar“ klingt, auch er ist wahr und da es bei uns – ich glaube, mit vielen guten Gründe – um das Individuum geht, soll dieses auch ein Recht darauf haben, sein Leben zu genießen. Und die Botschaft: Genießt euer Leben, aber gebt Gas dabei, ist irgendwie oft gegensätzlich.
Und auf irgendeiner Stufe der Entwicklung ist dann eben auch Schluss und Menschen zu bedrängen, sich weiter zu entwickeln, ist dann purer Stress, der Frust auf allen Seiten hervorbringt, aber mit Sicherheit keine bessere Welt.
Wie könnte eine Lösung aussehen?
Wir leben in einer Zeit des Hypes. Singender Superstar oder Supermodel soll und will man werden und dafür tun wir Menschen was. Alles wird benotet, im Moment: ob man kocht, heiratet oder Freunde einlädt. Lebenslang ausgedehnte Schule. Auch Entwicklung könnte man hypen, mit den Möglichkeiten unserer Zeit. Natürlich bedient das genau die ziemlich stereotypen Rollenbilder, die wir nun schon etwas über die Schmerzgrenze strapazieren. Exemplarisch hier Böhmermanns Rund-um-Gegenschlag zur deutschen Pop-Industrie, die supermegaauthentische Produkte nach Schema F raushaut, die allesamt so echt, so real, so deep sind, wie Margarinewerbung. Dass nicht mal das so richtig schwarz und weiß ist, zeigt auch diese Reaktion auf die „Eier aus Stahl“. Und so brechen und überlagern sich die Vorstellungen von dem, was man mögen darf und muss ein weiteres Mal und kumulieren in der Frage, was eigentlich meins ist.
Es wäre schön mehr davon zu hören, Modelle und Vorbilder dafür zu haben, wie man mit den Extremen der radikalen Erfüllung von Rollen und Klischees und ihrer ebenso radikalen Zurückweisung anders umgehen kann, reifer, selbstbewusster. Sich die Frage warum man will, was man will zu stellen, ist keinesfalls vertane Zeit, sondern heißt das Trainingsgelände zu betreten, auf dem die reflexive Struktur immer fitter wird. Die reflexive Struktur zu etablieren und die Arbeit an sich, ist in dem Sinne ein Dienst an der Menschheit. Ein Dienst, der lustvoll sein kann, denn ein reflexives Leben zu führen, heißt, ein reicheres Leben zu führen. Sich eine Zeit lang im Klischee und Kitsch zu suhlen ist auch okay, wenn es das Lebensgefühl ist. Diejenigen, die zu mehr Lust haben, können ja dann Gas geben, wenn sie den Ruf in sich vernehmen. Alles weitere geht nur in individueller Regie und Verantwortung, aber es spricht viel dafür dass wir einander vertrauen dürfen, wenn dieser Drehpunkt 5 erst mal erreicht ist.
Danach darf es auch gerne mal exzentrisch weiter gehen und gar nicht so selten scheint es so zu sein, dass die vorgebliche Ersatzhandlung, der Mangel, zuweilen, das am Ende reichere und glücklichere Leben hervorzubringen in der Lage ist. (Niemand hat das so facettenreich eingefangen, wie Carl Spitzweg.) So ist das Schlechte des Guten auch zu umgehen. Irgendwann kam man nicht mehr mit, wollte oder konnte nicht mehr alles richtig machen, stieg aus oder musste aussteigen, aus dem ewigen Wettlauf und ließ sich einfach fallen, in ein Leben, das das eigene war.
Quelle:
- [1] Ken Wilber, Das Spektrum der Psychopathologie, in: Wilber, Engler, Brown et al., Psychologie der Befreiung, Scherz 1988, S.125



