Arroganz ist ein unangenehmer Charakterzug, der uns im täglichen Sprachgebrauch in einer Vielzahl synonymer Begriffe begegnet: Hochmut, Stolz, Hybris, Anmaßung, Überheblichkeit, Hochnäsigkeit, Einbildung. Das betrifft Menschen, die plump, gerne aber auch subtiler prahlen und sich die anderen auf Distanz halten, weil sei meinen, etwas Besseres zu sein und sich für chronisch überlegen halten. In vielen religiösen Traditionen wird die Arroganz als Charakterschwäche angeprangert, in der Psychologie wird sie oft als eine Art Kompensation und Selbstschutz vor gefühlter Kleinheit oder Bedeutungslosigkeit gedsehen, was einerseits stimmt, andererseits zu kurz greift, wenn man den Antrieb des Arroganten tiefer verstehen will. Also, warum er ist, wie er ist.
Arroganz hat zwei Seiten
Das eine Gesicht der Arroganz ist die Selbstüberhebung und die Herabsetzung anderer: Ob durch Besitz, Bekanntschaften, Wissen, mit dem man protzt oder subtiler, in dem man zu verstehen gibt, dass man plakative Protzerei gar nicht nötig hat, da diese ohnehin nur etwas für den Pöbel ist. Der andere wird weggewischt, wie lästige Schuppen vom Jackett. Die Aura von: „Als ob ich es nötig habe, mich mit diesem minderwertigen Quatsch abzugeben, geh‘ mir aus der Sonne.“
Eine fraglos häufige Seite, aber die Arroganz hat noch eine andere, die von einem tiefen und unbewussten Wunsch nach Selbstzerstörung durchdrungen ist. Wobei die arrogante Seite in dem stillen Genuss oder besser Triumph liegt, dass es niemanden gibt, der den arroganten Menschen wirklich und in Tiefe verstehen und helfen kann. Das merkwürdig elitäre Gefühl, dass der andere gar nicht wissen kann, wie es einem geht. Weil niemand verstehen kann, was man selbst gerade durchmacht und damit werden dem anderen ein ausreichendes Maß an Intelligenz und Einfühlungsvermögen oder Empathie abgesprochen.
Demzufolge ist es für die Aufrechterhaltung dieser arroganten Pose auch wichtig, dass es tatsächlich niemanden gibt, der einem helfen kann. Denn das würde ja bedeuten, dass der andere durchaus versteht, was einem fehlt und effektiv helfen kann, was wiederum den Preis hätte, dass man die Leistung des anderen anerkennen müsste. Es ist eine große, wenn auch unbewusste Lust, den anderen dabei an der Leine zu zappeln und letztlich fallen zu lassen. Als Koryphäen-Killer-Syndrom ist diese Haltung in die medizinische Literatur eingegangen, zu finden ist sie aber auch in anderen Bereichen, in denen man sich selbst als im Grunde aussichtslosen Fall präsentiert, an dem sich bislang jeder die Zähne ausgebissen hat. Doch irgend jemandem, mit einen speziellen Verfahren oder besonderer Reputation will man noch mal „eine Chance geben“ und damit wird man zu demjenigen, der Schicksal spielt. Statt dessen ginge es darum, zu erkennen, dass man jemand ist, der Hilfe braucht. Zur vorhersehbaren Choreographie gehört es, dass der sich nun nach besten Kräften abmühende andere durch ein paar hoffnungsvolle Anfangserfolge selbst ein wenig narzisstisch gepäppelt wird, um dann doch irgendwann einen Fehler zu machen und fatal zu scheitern.
Oft nehmen Menschen, die unter dieser Art von Arroganz leiden erhebliche Selbstschädigungen in Kauf, mit denen sie durchaus einverstanden sind. Denn, dass es ihnen immer schlechter geht und sie damit anderen zeigen können, was diese für Versager sind – und das, nachdem man sich gerade ihnen so vertrauensvoll wie nie und niemandem geöffnet hat – gehört zur unbewussten Inszenierung. Manchmal schlägt die Arroganz dabei in ihr Gegenteil um, nämlich in eine ebenfalls entwertende Selbstherabsetzung, mit der man dem anderen allerdings erneut klar machen kann, dass die ganze Mühe, die er sich gibt leider umsonst ist. Bestimmt ist es gut gemeint gewesen, vermutlich hilft es auch tatsächlich bei anderen, aber leider ist man selbst nicht in der Lage davon zu profitieren, weil man einfach zu dumm, zu unfähig, zu gestört ist. Alles in allem gelten für den Betroffenen scheinbar ganz eigene Regeln und die hat eben leider bislang niemand gefunden und es wird sie auch niemand finden.
Erneut ist die Selbstherabsetzung, eine andere Art der Selbstschädigung, etwas, was man in Kauf nimmt, um von der arroganten Unerreichbarkeit nicht abrücken zu müssen. Aber diese Haltung legt immerhin den Blick frei und verdeutlich, worum es auch geht:
Das unbewusste Ziel ist die Zerstörung jeder tieferen Kommunikation
Wie ein Stück Seife in der Dusche ist der arrogante Mensch eigentlich nie zu fassen. Entweder er steht Meilen über dem anderen und schaut belustigt bis spöttisch auf die Klimmzüge, die jener da macht oder, wenn der andere beharrlich bleibt und sich nicht beirren lässt, ist der arrogante Mensch selbst der, der das alles nicht versteht oder durchhält und dem das alles viel zu kompliziert ist. Es ist wie im Märchen vom Hasen und Igel, in dem der schnelle Hase mit dem Igel eine Wettrennen macht, doch auf der anderen Seite steht immer schon ein zweiter Igel und sagt dem Hasen: „Ich bin schon da.“ Arroganz agiert so ähnlich, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Wo immer man meint sie anzutreffen, hat sie die Botschaft zur Hand: „Ich bin schon weg (und du wirst mich auch niemals erreichen).“
Ein an sich sehr intelligentes Spiel, was Selbstschädigung einsetzt, um den anderen zu degradieren. Denn eine Begegnung auf Augenhöhe ist etwas, was in der Welt der Arroganten niemals stattfinden wird. Das geht bis zum Syndrom der Arroganz, das typisch bei Menschen mit schwerer Persönlichkeitsstörung ist. Das können im Einzelfall sehr intelligente Menschen sein, etwa angesehene Professoren, die dann auf einmal, scheinbar nicht mehr in der Lage sind, einfachste Argumente und rationale Zusammenhänge zu verstehen. Man wundert sich durchaus, wenn intelligente Menschen ganz plötzlich solche Aussetzer haben und scheinbar überhaupt nicht verstehen, was man meint, obwohl sie spielend ganz andere Schwierigkeitsgrade bewältigen. Das unbewusste Ziel ist hier, eine kommunikative Begegnung auf Augenhöhe zu verhindern, mit allen Möglichkeiten der Sabotage. Entweder der andere ist gefühlt zu unbedeutend, um ihn überhaupt wahr-, geschweige ernstzunehmen. Das ist der Standardfall der Arroganz; oder der andere erscheint übergroß und man meint mit ihm überhaupt nicht mithalten zu können; oder das plötzliche Nichtverstehen setzt ein, auch hier fällt die Kommunikation aus.[1]
Das letzte Ziel dieser Haltung ist, sich vor der Einsicht in die tiefen Aggressionen zu schützen, die einen beherrschen. Wer eine gleichberechtigte Begegnung nie erlebt, aber die prickelnde Aggression, die in der Entwertung liegt dafür umso häufiger als Zeuge oder am eigenen Leib und der eigenen Psyche gespürt hat, der kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass Gleichberechtigung eine reale Option der Kommunikation ist. Wenn überhaupt, dann höchstens als Masche oder Trick, da die Welt ein Schlachtfeld ist, auf dem mit allen Mittel gekämpft wird. Wenn Aggression erlebte und gefühlte Realität ist, man aber schlau genug ist, um zu begreifen, dass sie offen zu leben und zu agieren unerwünscht ist und sanktioniert wird und das Temperament es einem gestattet, sich zu bremsen, ist Arroganz ein Mittel um einen Kompromiss zu finden. Weltekel, Hass und Verachtung können unter einem Mantel oberflächlicher Höflichkeit zu einem Teil kaschiert werden, die Entwertungen kommen kühl und definitiv daher, der andere wird einfach stehen gelassen, als existierte er gar nicht, nichts an ihm erscheint es wert überhaupt zur Kenntnis genommen zu werden.
Wenn Arroganz zur Ideologie wird
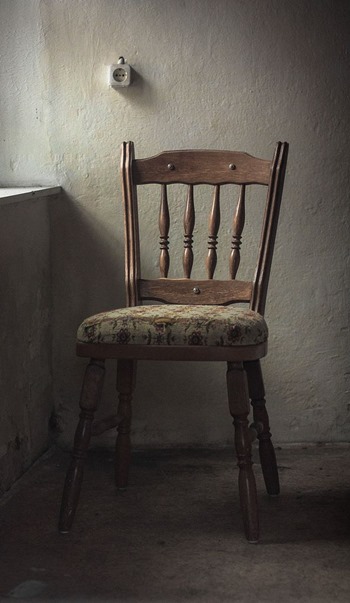
Die Welt der Arroganz ist ofr eine einsame. © Waldemar Merger under cc
Ich begann mit der Darstellung von Hilfesuchenden in medizinischem, psycho- oder paartherapeutischem Kontext, die oft durch jahrelanges Leiden zum Experten in eigener Sache geworden sind. Das ist an sich sehr gut, da diese Menschen tatsächlich oft sich und ihre Reaktion auf bestimmte Angebote besser kennen, als sonst jemand. Weniger gut ist es, wenn dieses Wissen in aggressiver und selbstaggressiver Weise dazu benutzt wird, dem anderen zu erklären, wieso das, was er vor hat ohnehin nicht glücken kann und wird. Dass man zwar sich selbst bestens kennt, das Gebiet und die Fähigkeiten des anderen aber nicht, wird dabei geleugnet. Das Bemühen des anderen und die prinzipielle Möglichkeit, durch guten Willen, Intelligenz und Empathie die Kluft, die unsere Innenwelten immer trennt, zu schließen oder mindestens zu verringern, wird dabei auch als unzureichend angesehen.
Ideologisiert wird die Arroganz in dem Moment, wo man jemandem, die Fähigkeit den anderen zu verstehen abgespricht, weil er aus einer anderen Lebenswirklichkeit stammt. So dass man als Mann nicht in der Lage sein kann, eine Patientin überhaupt zu verstehen. Auch eine Therapeutin, die in einer derart männerdominierten Welt erfolgreich arbeitet, kann natürlich ebenfalls nicht in der Lage seinm die Patientin zu verstehen. Schließlich hat sie sich der Männerwelt unterworfen und so kommt unterm Strich heraus, dass niemand ihr helfen kann, außer einem Menschen, der genau wie sie ist und daher zu dem Schluss kommen müsste, dass ihr nicht zu helfen ist. Umgekehrt kann natürlich auch ein arroganter Mann der Meinung sein, eine Frau könne ihn sowieso nicht verstehen und ein männlicher Therapeut, der in einem so weibischen Bereich arbeitet und sein Brot mit Gerede verdient, nicht erfassen kann, worunter er leidet.[2]
Dass heterosexuelle Menschen keine homosexuellen verstehen können und umkehrt, Weiße keine Farbigen und umgekehrt, Atheisten keine religiös Gläubigen und so weiter sind alles Variationen des einen Themas, oft noch garniert mit der arroganten Überzeugung: „Ich weiß genau, was Du denkst und fühlst, aber Du weißt nicht, was ich denke und fühle.“ Dass diese Grenze nie überwunden werden kann, ist arroganten Menschen sehr wichtig. Wie kann man sie dennoch überwinden?
Deuten und auf Augenhöhe gehen
Zunächst einmal ist das alles andere als leicht, weil die grundlegende Aggression, die hier verborgen ist, oft in schwerer Form vorliegt, also massiv abgewehrt und geleugnet wird. Wenn man überhaupt durchdringt, ruft dies oft schwere paranoide Reaktionen hervor, manchmal verbunden mit dem Vorwurf, dass man den ohnehin schon leidenden Menschen nun noch einmal aus purer ideologischer oder charakterlicher Bösartigkeit diskreditieren will. Nicht genug, dass man leidend ist, nun gelte man auch noch paranoid oder psychisch krank und damit als stigmatisiert.
Auch da gilt die Regel, dass man nicht die Nerven verlieren und die Motive konsequent deuten sollte. Das Spiel lautetr: „Du kannst Dich abstrampeln, wie Du willst, mir ist nicht zu helfen.“ „Nur wer anerkennt, dass mir nicht zu helfen ist, nimmt mich richtig ernst.“ Was wäre das absurde Hauptmotiv: „Nur wer will, dass ich sterbe oder es mir schlecht geht, meint es gut mit mir“? Psychodynamisch wäre das mit einem Zusammenfallen von Liebe und Aggression und einer Identifikation mit einem früheren Aggressor zu erklären. Die Absurdität des Motivs steht jeodch auch für sich.
Kernberg weist darauf hin, dass bestimmte aggressive und selbstdestruktive Verhaltensweisen auch unterstützend zu kontrollieren sind, aber auch, dass Kontrolle allein nichts daran ändert, dass die Problematik erhalten bleibt. Man sieht die Welt noch immer als feindselig an und Beziehungen als prinzipiell asymmetrisch.[3] Es gilt also, sie deutend zu lösen.
Man bekommt am ehesten und auch in Alltagssituationen einen Fuß in die Tür, wenn man mit eigener Arroganz dem Arroganten auf Augenhöhe begegnet. Da hier oft eine narzisstische Problematik den Hintergrund bildet und man aus dem Spiel ist, wenn man sich einem Narzissten unterwirft (er nimmt einen nicht mehr für voll, sondern ist allenfalls noch nützlich), aber wenn man überlegen ist, intensiven Neid aktiviert, der ebenfalls zur Entwertung und zu Abbruch der Kommunikation führen kann, ist es gut, wenn man dem Narzissten etwas zu bieten hat, was er interessant findet. Hier kann man ein Gespräch auf Augenhöhe, sozusagen von Genie zu Genie beginnen und sich dann langsam den realen Problemen zuwenden. Vielleicht ein schmales Brett, aber eines was trägt.
Dass eine Begegnung, die nicht symbiotisch und nicht asymmetrisch ist möglich erscheint, ist nichts, was sehr arrogante Menschen auf dem Schirm haben. Deutungen konfrontieren sie immerhin mit der Möglichkeit. In einer ohnehin sehr asymmetrischen Beziehung, gewöhnlich suchen und finden sich die Menschen, die, wenn auch unbewusst, gut zusammen passen, ist eine solche Konfrontation kaum möglich. Sollten sich innerhalb der Beziehungen die Kräfteverhältnisse ändern, ist die Möglichkeit gegeben, ansonsten nicht.
Formen der Arroganz
Die äußerste Form nennt Kernberg pervasive Arroganz, was auch soviel wie überall um sich greifende oder allesdurchdringende Arroganz bedeutet und meint, dass jede Begegnung von ihr durchzogen wird. Das ‚Syndrom der Arroganz‘ finden wir bei Menschen mit schweren Persönlichkeitsstörungen, aber es tritt auch vorübergehender auf.
Milde Formen der Arroganz kann man im Alltag beobachten, sicher auch oft im Zusammenhang mit einer narzisstischen Störung. Sie ist daher durchaus als Abwehr gegen eine gefühlte Kleinheit und ein an sich mangelndes Selbstbewusstsein denkbar. Man will mit vorgeschobener oder tatsächlicher Leistung zeigen, dass man doch nicht der Versager ist, für den man sich klammheimlich hält und man hat Angst davor, dass die anderen es entdecken. Gut vorstellbar, dass man sie sich damit auf Distanz hält, wenn man in arroganter Pose fragt, was die anderen einem schon zu sagen haben. Auch das spontane Nichtverstehen von an sich intelligenten Menschen, die plötzlich und unerwartet überhaupt nicht mehr verstehen, wovon man redet, kann eine Angst sein, als Ahnungsloser ertappt und erniedrigt zu werden.
Sicher gibt es auch gesunden Stolz, der einen selbst beglückt, weil man eine Aufgabe sehr gut erfüllt hat. Als Zugabe zur ebenfalls oftmals verdienten Anerkennung, ist das nichts Verwerfliches, solange man andere dabei nicht herabsetzt (für eventuellen Neid anderer kann man nichts, das ist deren Problem). Schön ist es, wenn man sich auch mit anderen freuen kann. Wie so oft finden wir auch hier ein fließendes Kontinuum, mit unterschiedlichen Schweregraden. Ein gelegentliches Aufkommen von Eitelkeiten und gelinder Arroganz ist sicher kein Drama und gehört zum Leben der meisten Menschen vermutlich dazu. Wir haben hier nur tiefer gegraben, um an die Wurzel der Arroganz zu kommen.
Gibt es konstruktive oder taktische Arroganz?
Eine interessante Frage, denn so wie ein Therapeut um überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen, sich auf Augenhöhe mit einem narzisstischen und arroganten Patienten begeben muss, so könnte es auch andere Situationen geben, in denen man sich eventuell zu einer gewissen taktischen Arroganz genötigt fühlt. Etwa, um nicht von Beginn an jemand zu sein, der wie ein Außenseiter oder Bittsteller daherkommt, sprich: um selbst ernst genommen zu werden. Theoretisch durchaus denkbar, liegt die Gefahr darin, dass es zum einen ein Spiel mit dem Feuer ist und gravierender, möglicherweise ein Schutz, eine Rationaliserung echter eigener Arroganz. Vor allem, wenn jemand beklagt, überall gezwungen zu sein, sich arrogant zu geben, obwohl er doch im Grunde ganz anders sei. Zudem werden arrogante Menschen vielleicht noch bewundert, in der Regel aber nicht gemocht. Die Forderung nach zu bedigungsloser Liebe ist vielleicht regressiv, da sie der Mutterliebe entspricht, die ihr Kind einfach dafür liebt, dass es da ist. Anerkennung, als Surrogat der Liebe, ist sicher auch gut und wichtig, aber Arroganz verhindert eher, dass man über die erbrachte Leistung hinaus noch gemocht wird. Dass andere Menschen einen darum etwas fies finden, weil man arrogant ist und sie auf Distanz hält, wäre für den Arroganten der zu Testfall, gegenüber der Version, dass die anderen einfach von Grund auf böse und missgünstig sind.



