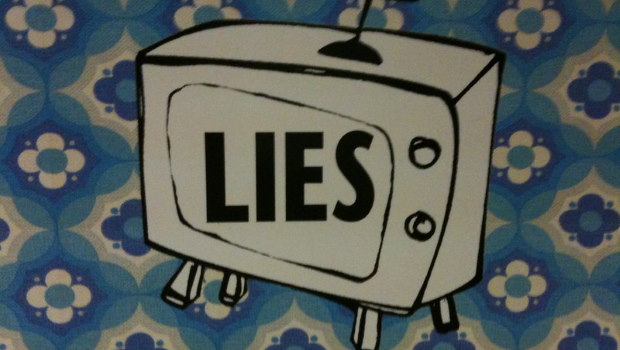
Auch die Massenmedien sind eine Quelle regressiver Seichtheit, die Lügen begünstigen. © Ged Caroll under cc
Es wird in letzter Zeit wieder viel über Lügen und Halbwahrheiten gesprochen. Oft geht es dabei um angeblich oder tatsächlich verdrehte Fakten, die man dann meint nur aufklären zu müssen.
Wenn man dies nur gründlich und genau genug macht, kommen wenigstens jene, die schlau genug sind, früher oder später zur Einsicht. Das ist in einigen Fällen richtig, doch aufs Ganze gesehen klingt es eher selbst nach einer Halbwahrheit. An dem ganzen Komplex um Lügen und Halbwahrheiten kann man jedoch sehr schön erkennen, dass es um mehr als kognitive Einsicht geht, wir können mehrere Entwicklungslinien bei der Arbeit betrachten, vor allem die kognitive, die emotionale und die moralische.
Lüge und Irrtum, Wahrhaftigkeit und Wahrheit
Die Lüge ist immer einer bewusster Akt. Wer lügt, weiß, dass es anders ist, aber durch das Hinzufügen oder Auslassen von entscheidenden Aspekten verdreht man die Wahrheit ein wenig. Manchmal, weil es aktuell einfacher scheint und man drohenden Schwierigkeiten meint bequem aus dem Weg gehen zu können. Was kurzfristig klappt, führt hier und da zu größeren Schwierigkeiten, wenn die aufgetischten Lügen anfangen, einander zu widersprechen. Dann kann oft eine weitere Lüge die Situation retten und man begibt sich immer tiefer in einen Wald der immer unübersichtlicher wird. Das ist anstrengend und erfordert beachtliche Kreativleistungen.
Die grundsätzlich andere Möglichkeit besteht darin, sich an irgendeiner Stelle wider ehrlich zu machen und zu sagen, dass man gelogen hat – nicht jede Lüge ist ein großes Ding – und warum man es tat. Vielleicht versteht der andere, warum man an dieser Stelle gelogen hat, kann es nachvollziehen und die Sache ist vom Tisch. Vielleicht meint das Gegenüber aber auch, eine Lüge sei unnötig gewesen und man hätte von Anfang an besser die Wahrheit sagen sollen. Das kann die Beziehung klären und in besten Fall sogar vertiefen, im ungünstigen Fall sinkt das soziale Ansehen. Aber so oder so, wer lügt, weiß, was er tut.
Beim Irrtum ist das anders. Er ist dadurch gekennzeichnet, dass man überzeugt ist, dass das, was man behauptet wirklich so ist. Sei es, was die Höhe eines Turms betrifft, die Einwohnerzahl von Brasilien, was jemand auf einer Feier gesagt hat oder wie es genau war, als man sich zum ersten mal kennen lernte. Hier finden wir wirklich oft ein Faktenwissen, bei dem man sich einfach geirrt hat. Heute zückt man in der Regel sein Smartphone, schaut bei wiki oder sonst wo nach und die Sache ist geklärt, bei der Frage nach der Feier oder dem Kennenlernen fragt man gewöhnlich andere, die dabei waren. Jeder hat seine Version, eine Restunsicherheit wird bleiben, aber die kann man in der Regel gut ertragen und etwaige Fragen oft klären. Der Irrtum ist nie vorsätzlich, man denkt wirklich, es sei so, wie behauptet.
Insofern ist der Irrtum wenn jemand nicht übermäßig trotzig und bockig ist, schnell aus der Welt und korrespondiert mit jenem Aspekt der Wahrheit, der auf Faktenwissen zu reduzieren ist. Anders ist es bei der Lüge. Da man weiß, dass man lügt, wenn man lügt, ist der Hinweis auf die Fakten irrelevant. Was hier fehlt, ist die Wahrhaftigkeit oder Redlichkeit, das Wissen darum, vor allem aber das Gefühl der Verpflichtung darauf, dass man nicht lügen sollte. Das nicht nur theoretisch, so dass man brav referieren kann, man wisse, dass man bei der Wahrheit bleiben sollte, sondern als eine Verpflichtung, der man sich verschrieben hat. Eine Verpflichtung vor sich und anderen, die auch dann andauert, wenn man nicht kontrolliert wird. Das betrifft das innere Wertesystem, das Gewissen und im Folgenden besonders die Frage, wie stabil und ausgeprägt es ist. Man ist nicht einfach gewissenhaft oder gewissenlos, sondern es sind feine Zwischenschritte, die man findet und die das Thema wirklich interessant machen.
Halbwissen und Halbwahrheiten
Wie bei Wahrheit und Wahrhaftigkeit haben wir bei Halbwissen und Halbwahrheiten einmal einen rein kognitiven Aspekt, beim Halbwissen. Zum anderen einen Komplex aus Kognition, Emotion und Moral oder Werteempfinden, bei den Halbwahrheiten.
Das Halbwissen ist im Grunde schnell erklärt. Je nach der Fähigkeit Informationen zu verarbeiten, entsteht aus dem Gesamtkomplex der Informationen über ein bestimmtes Gebiet, ein Bereich, den man durchschaut und verarbeiten kann. Oft sind das solche, in denen man geringe oder gar keine Kenntnisse oder Fähigkeiten hat, in Themengebieten, die emotional nicht stark besetzt sind. Man weiß in der Regel nicht so ganz genau, wie das eigene Smartphone wirklich funktioniert, kann die Unterschiede zwischen VWL und BWL nicht immer auf die Praxis beziehen, kennt die Vorteile des Allgäuer Braunviehs in der Viehwirtschaft oder des Knick Shots beim Squash nicht aus dem Stehgreif und auch nicht den Begriff der Singularität in der Kosmologie und bei Reckwitz, den Inhalt der Kontroverse zwischen Habermas und Luhmann oder der zwischen Kohut und Kernberg. Aber selbst wenn man wenig über diese Gebiete weiß, kommt man auch so gut durchs Leben und pocht nicht unbedingt drauf hier Experte zu sein oder dies wissen zu müssen.
Anders bei der Halbwahrheiten. Hier ist man emotional und moralisch beteiligt. Vielleicht kennt man sich auch hier nicht besonders gut aus, ist selbst aber ganz anderer Ansicht. Bei bestimmten Themen hat man schnell den Eindruck, hier wisse es jeder besser, die Klassiker sind Fußball und Politik. Weil man mal vor 40 Jahren in der Jugendmannschaft gespielt hat oder man weiß, dass die Politiker sowieso keine Ahnung haben. Einige meinen genau zu wissen, wie die Wirtschafts- oder Klimaprobleme ganz schnell und einfach zu lösen wären, kennen die Wahrheit über Corona-Viren oder Migration. Oftmals nicht einfach so, sondern weil sie sich mit dem Thema recht intensiv beschäftigt haben und dabei irgendeine Variante des Themas besonders überzeugend finden und in ihren Augen ein bestimmter Experte derjenige ist, der alle anderen überstrahlt.
Wenn die von ihnen favorisierten Experten oder Theorien in der Fachwelt nicht so gut ankommen, gilt vielen das als Beleg, dass der Mainstream unbequeme Meinungen unterdrückt und ist nicht selten noch mehr davon überzeugt, dass die eigene Wahl goldrichtig ist. Wenn hinter einem Thema emotionaler Druck ist, zuckt man nicht so einfach mit den Schultern, wenn man davon nicht viel versteht, sondern behauptet, sich bestens auszukennen. Aber häufig nur in der Gedankenwelt der eigenen Lieblingsidee oder des auserwählten Experten, der einem dann manchmal noch erklärt, wo und warum alle anderen falsch liegen und in Wahrheit doch alles ganz einfach wäre.
Oft ist es so, dass die eigenen Halbwahrheiten sich selbst schützen. Das ist einerseits gut und andererseits schlecht. Schlecht ist, dass Halbwahrheiten eben tatsächlich nie ganz falsch sind. Ist man Anhänger eines Außenseiters einer Zunft und kennt dessen Argumente, so werden diese in der Regel teilweise stimmen. Man müsste als Anhänger einer Theorie also nachvollziehen können, an welcher Stelle jemand anders abgebogen ist, als die anderen und die Sichtweisen beider Seiten dazu kennen und durchdringen. Selbst dann ist die Sache oft noch unklar, weil Entscheidungen, die viele Menschen oder sehr komplexe Sachverhalte betreffen keine ganz oder gar nicht Auswirkungen haben. Lässt man sich auf Diskussionen ein, die tiefer gehen könnten, schalten viele leider in dem Moment ab, wo sie die Bestätigung dessen hören, was sie hören wollen.
Gut ist, dass hinter den Einstellungen, die uns emotional berühren ein bestimmtes Weltbild steht, was jedem einzelnen hilft, sich in seiner Welt zurecht zu finden. Vieles in unserem Leben ist gut zu verstehen, aber wir sind heute mehr und mehr in Bereiche vorgestoßen, die sehr komplex sind. Wenn man diese nicht verarbeiten kann, hat man nicht das Gefühl, dass man das alles nicht mehr versteht, sondern, dass vieles Gerede, komplizierter und überflüssiger Kram ist, den kein Mensch braucht. Unser Weltbild ist eng mit unserem Selbstbild verbunden und das ist zum Glück in vielen Fällen gnädig, so dass wir unsere Art der Weltanschauung als die beste ansehen. Das Gefühl die Welt nicht richtig zu verstehen ist nichts, womit man andauernd leben kann. Also versteht man sie selbst richtig – unsere Psyche sorgt dafür –, die die weniger verstehen findet man primitiv und wer mehr versteht, macht sich aus dieser Sicht unnötige Gedanken oder ist irgendwie verpeilt.
Bis hier hin ist es noch einfach. Es ist zwar manchmal anstrengend – gelegentlich aber auch sehr faszinierend – Menschen zu begegnen, die mit großer emotionaler Wucht bestimmte Thesen vertreten. Man stimmt ihnen zu oder lehnt sie ab, aber wie kann man eigentlich erfassen, was in ihnen selbst vorgeht?
Das langsame Aufweichen moralischer Standards aus innerer Überzeugung
In dem Artikel über Liebesbeziehungen ist von einer narzisstischen Frau, ohne antisoziale Tendenzen die Rede, die aus ihrer Sicht ganz offen und ehrlich, im Abstand von wenigen Tagen, eine intime Beziehung mit zwei Männern eingeht und beiden versichert, dass sie sie lieben würde und sie die einzigen Männer in ihrem Leben seien. Sie betont dabei stets ehrlich gewesen zu sein und in der Therapie war ihr ihre eigene Ehrlichkeit ein ihr sehr wichtiger Punkt, in dem sie betonte, dass sie von Anfang an niemanden ewige Liebe garantiert hätte.
Ein bedeutender und schwieriger Aspekt, denn im Grunde ist es ein konsistenter Standpunkt. Man kann von niemandem etwas verlangen, auf was er sich von Beginn an nicht einlassen wollte. Die Männer haben das Spiel erst mitgemacht, aber natürlich darf jeder, der eine intime Beziehung eingeht, sich die Hoffnung machen, der einzige Mensch zu sein, gerade, wenn dies von der anderen Seite noch beteuert wird. Die Wechselhaftigkeit der eigenen Emotionen zu betonen, so nach dem Motto: ‚Woher soll ich heute wissen, was ich nächste Woche empfinde?‘ ist der springende und heikle Punkt. Denn einerseits stimmt das ja, im Leben kann auch in kurzer Zeit allerlei passieren, doch unter normalen Bedingungen ist man eben doch auch in der Lage Auskünfte über die Redlichkeit und Dauerhaftigkeit der eigenen Empfindungen zu geben und man und oder sollte wissen, was allgemein erwartet wird.
Genau dort ist auch die offene Flanke, denn ein Mensch, der den Aspekt der Sorge in Beziehungen leugnet, kann immer argumentieren, dies sei einfach nur ein konventionelles Spiel, auf dass man dressiert werde und dass es viel authentischer sei, sich nicht darauf einzulassen. So wird jeder, der an die Verantwortung appelliert, zu einem reaktionären Spießer und nicht selten wird ja auch die Psychologie selbst als Ausgeburt überkommener Wertvorstellungen gedeutet. Aber was ist jetzt wahr, wo im Grunde zwei Deutungssysteme gegeneinander stehen? Stellen wir diese Frage kurz zurück, ohne sie zu vergessen.
Verlogene Ehrlichkeit oder der Wunsch der Kontrolle
Nicht nur die Leugnung moralischer Verantwortung kann problematisch sein, sondern ihr Gegenteil ebenfalls. In so einer Konstellation einer Paarbeziehung kann bei einem der Partner der Wunsch vorliegen, man solle als Paar stets offen und ehrlich miteinander sein und gerade weil man sich liebt, sollte das doch überhaupt kein Problem sein. Auch hier ist es schwierig gegen die Konsistenz der Gedanken zu argumentieren.
Aber der Wunsch nach Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit kann auch schnell in ein Ausfragen übergehen. „Wo warst du? Mit wem? Warum kommst du erst jetzt? Wir wollten doch immer ehrlich sein.“ Oft versucht der eine, der die Ehrlichkeit beansprucht noch ‚mit gutem Beispiel‘ voran zu gehen und dem anderen detailliert zu erzählen, was er tut, fühlt und denkt, man könnte den Eindruck haben, um den Druck zu erhöhen. Die Möglichkeit, dass der andere das gar nicht lückenlos erzählen will, aber dennoch nichts im Schilde führt, was die Beziehung gefährden würde, wird von vorn herein ausgeblendet. Dahinter steht eine eingestandene oder uneingestandene Angst, die aus einem Mangel an Vertrauen in den anderen resultiert. Dieses Vertrauen, das man – oft garniert und rationalisiert in einer Geschichte vorangegangener Enttäuschungen – dem anderen nicht schenken kann, soll dann durch Kontrolle ersetzt werden.
Erkennbar ein Teufelskreis, der Partner wird sich eingeengt und ausgehorcht fühlen, das führt unweigerlich zu Spannungen, auf der einen Seite wachsen die Tendenzen sich der Kontrolle zu entziehen, auf der anderen in gleichen Teilen das Misstrauen. Ist die Beziehung erfolgreich zerstört, kann der Misstrauische sagen, es doch schon im Vorfeld gewusst habe, fühlt sich bestätigt und das Drama nimmt seinen Lauf. Bei der nächsten Beziehung ist man um eine weitere Enttäuschung reicher, wird noch vorsichtiger und fordert totale Ehrlichkeit ein, ohne den eigenen Anteil am Scheitern zu erkennen.
Wer Ehrlichkeit einfordert, dem kann man schwer unterstellen zu lügen. Es ist auch in diesem Fall keine Lüge, sondern ein Schutz vor der Selbsteinsicht ein starkes Kontrollbedürfnis zu haben. Wenn man es sich eingesteht, wird es zudem oft rationalisiert: die schlechten Erfahrungen. Man weiß nicht, was zuerst war, klar ist aber, dass man die anderen schwer für die eigenen Probleme verantwortlich machen kann. Wer ein zu großes Bedürfnis nach Kontrolle hat, muss dies erkennen und zwar im Zusammenhang damit, dass man sich so die Probleme selbst schafft, die man verständlicherweise nicht haben möchte. Ab einer gewissen Tiefe der Pathologie wird so eine Einsicht projiziert und ein Hinweis entweder freundlich-arrogant abgebürstet oder als verfolgend erlebt, schließlich ist man doch selbst geschädigt.
Die Fähigkeit vertrauen zu können, kann man nicht mal eben einschalten, aber eine Psychotherapie kann diese paranoiden Problematik bessern oder lösen.
Verletzende Ehrlichkeit, oder: Wie offen muss man sein?
Ehrlichkeit oder Wahrheit kann auch verletzen. Manchmal trifft man auf diese herausfordernd aggressive Seite, nicht unbedingt in intimen Partnerschaften, sondern schon im oberflächlicheren Umgang mit einander. Das beginnt damit, dass man einen anderen Menschen taktvoll auf etwas hinweisen kann oder ihn öffentlich bloß stellen. Manche verstecken ihre Taktlosigkeit und Aggression dahinter, dass sie angeblich nur ehrlich sind und leugnen im Grunde auch da den Gesamtkontext. Man muss von einem Menschen erwarten dürfen, dass er einschätzen kann, wann man jemanden diskret zur Seite nimmt, statt ihn öffentlich zu demütigen.
Doch es gibt noch eine andere Haltung, nämlich die von Menschen, die der Ansicht sind, jemand sei nur richtig ehrlich, wenn er mir sagt, dass er mich für einen Drecksack hält. Wenn jemand sagt, man sei ein netter, sympathischer Mensch, so ist das eine Lüge, denn eigentlich weiß man ja, dass Menschen im allgemeinen nichts voneinander halten und sich bestenfalls ausnutzen. Wer das zugibt, ist wenigstens ehrlich, die anderen halten nichts von einem und lügen obendrein noch.
Die Grundeinstellung ist gesetzt: Menschen halten nichts von einander. Daran gibt es auch nichts zu rütteln. Diese negative Haltung zieht sich durch, wie ein roter Faden. Menschen halten nichts von einander, sie verletzen einander, wenn sie ehrlich sind oder sie belügen einander. Die Begründung schützt sich immer wieder selbst und ist zirkulär. Wer was anderes denkt, ist naiv, wer zustimmt ist Realist, stimmt aber eben zu, dass es um unser Miteinander nicht gut bestellt ist.
Wie Entwicklungslinien von einander abhängen
Wenn das alles wahr ist, gibt es keine Moral. Oder besser: Moral ist dann eine beliebige Erfindung, womöglich von Schwächlingen, ohne jedes Fundament. Man nimmt Rücksicht auf einander, weil man sich nicht zutraut, sich durchsetzen zu können. Gemeinsamkeit wird dabei unter dem Aspekt der Konkurrenz betrachtet. Oft mit dem ‚Argument‘, das Leben sei nun mal so, die Natur sei hart.
Daran stimmen gleich zwei Dinge nicht. Erstens, ist der Blick auf Aggression und Konkurrenz nur ein Aspekt der Natur. Zweitens, ist es ein naturalistischer Fehlschluss, aus dem Sein (wie es ist) ein Sollen (dass es so auch gut und richtig ist) abzuleiten. Doch die Natur kennt neben der Konkurrenz ohnehin auch eine kooperative und sorgenvolle Seite, spätestens einsetzend bei den höheren Säugetieren und den Affektdispositionen, die eine gezieltere Brutpflege ermöglichte.
Der Schutz vor Verantwortung ist nicht nur der Schutz davor für jemand anderen gerade stehen zu müssen. Die andere Seite ist die Einstellung, dass niemand für mich verantwortlich ist. Dahinter steht die narzisstische Idee niemanden zu brauchen, niemandem Dank zu schulden und alles allein hinzubekommen. Der Schutz vor wechselseitiger Verantwortung, ja die Leugnung, dass es sie wirklich gibt, ist gleichzeitig der Schutz vor Liebe. Die Liebe in intimen Paarbeziehungen besteht (mindestens) aus der Vereinigung von sexueller Leidenschaft auf der einen, sowie Zärtlichkeit und Sorge um den anderen und die gemeinsame Beziehung, auf der anderen Seite. Die Leidenschaft wird nicht geleugnet, wenn man mehrere Partner zur gleichen Zeit hat, aber dass Liebe eben auch bedeutet, dass mir ein anderer Mensch wichtig ist, auch über den Moment hinaus, dass er abhängig von mir ist und ich von ihm, ist die Einsicht, vor der man sich schützt. Diese Sicht reiht sich ein, ist eine milde Form des roten Fadens, der sich durch eine negative Grundeinstellung zieht, in der Menschen einander prinzipiell unfreundlich begegnen, sich verletzen, benutzen und unaufrichtig im Umgang miteinander sind.
Dieser Glaube an wechselseitiges Desinteresse kann in so widersprüchlichen Erscheinungen wie der Lüge, dem Wunsch nach absoluter Ehrlichkeit und Offenheit oder auch der Weigerung sich festzulegen auftreten. Was aber ebenfalls erkennbar wird, ist, wie bestimmte Denkmuster, die in aller Regel zirkulär begründet werden und damit nicht oder falsch begründet sind, ein spezifisches emotionales Erleben, was um sich selbst kreist und die eigenen Einstellungen auf andere in einer projektiven Identifikation überträgt, sowie eine damit assoziierte moralische Einstellung, dass eben alle so sind und man sich nicht vormachen soll, Hand in Hand gehen.
Wachsende Aggression und schwindende Verantwortung im Umgang mit anderen
Der Grad in dem Aggression in den wechselseitigen Umgang getröpfelt wird und der Mangel an Liebe entsprechen einander. Wer sich vor der Verantwortung für eine Beziehung schützt, schützt sich auch vor dem sorgevollen Aspekt der Liebe. Da ein gesundes, integriertes Ich aber mehr oder minder gleichbedeutend mit einem Ich ist, das überwiegend intakte Beziehungen zu anderen erlebt hat, eingehen kann und ganz einfach normal findet, hängen auch diese Bereiche zusammen.
Sich und den anderen als wirklich eigenständigen Menschen sehen und wertschätzen zu können, mit eigenen Vorstellungen, Wünschen und Sichtweisen, ist das was fehlt, wenn das eigene Ich schwach ist. Beziehungen zu anderen pendeln dann zwischen kühlem Funktionalismus und Verschmelzungswünschen hin und her. Beiden ist gemeinsam, dass der andere nicht als eigenständiger Mensch gesehen wird. Beim Funktionalismus ist er eine Art Dienstleister oder eine Figur in dem großen Strategiespiel, als das das Leben dann meist betrachtet wird. Bei den Verschmelzungen wird der andere vereinnahmt und als Kopie der eigenen Wünsche dargestellt, das höchste Ideal ist, dass der andere genauso wird, wie ich bin oder mein idealisiertes Ich zu sein scheint.
Dieser Zusammenhang existiert nicht nur in intimen Zweierbeziehungen oder engen Freundschaften, sondern in allen Bereichen des Lebens, in abgeschwächter Form. Auch Bekanntschaften oder Arbeitsbeziehungen. Diese haben einen höheren funktionalistischen Anteil, aber dieser sollte nicht alles überragen. Der andere muss immer auch noch als Mensch gesehen und gewürdigt werden.
Diese Stelle ist hochinteressant, weil es prinzipiell andere Sichtweisen gibt und die bloße Gewohnheit mit der viele von uns immer noch den Wert des Individuums hochhalten, noch kein Argument ist. Dass Kant uns ins Stammbuch geschrieben hat, man solle den anderen nicht ausschließlich als Mittel zum Zweck sehen und das Christentum auf Nächstenliebe pocht (ohne als Kirchentum besonders genial in der Umsetzung zu sein), ist die eine Sache, doch es gab auch Nietzsche und auch mitten in Europa Einstellungen, in denen das Individuum weniger gewürdigt wird.
Immerhin sieht man sich bisweilen noch genötigt sich zu rechtfertigen und auch hier sehen wir eine Ablehnung der Verantwortung, nach dem gleichen Muster, wie oben geschildert: zirkuläre Begründungen, eine lieblos-funktionalistische Emotionalität und daraus resultierend eine Korrumpierbarkeit, also ein moralischer Einbruch. Zu dem Fehlschluss, dass das Leben eben so ist, gesellt sich ein weiterer: Das machen doch alle. Man selbst ist sogar so ‚ehrlich‘ und tut nicht so, als ob es anders sei, steht also moralisch sogar noch besser da, weil man nicht so tut, als ob.
Das ist falsch, weil Verantwortung und Sorge (und weitere Empfindungen) bei der Überzahl der Menschen existieren. Nur bekommen ich-schwache Menschen diese Emotionen nicht zu fassen und denken, diese seien ein verlogenes Spiel. So übergeht und untergräbt man sein Gewissen, auch wenn es schon richtig ist, dass auch dann, wenn man gründlich nachdenkt und seine Erfahrungen rekapituliert, man findet, dass menschliches Miteinander durch die Frage geprägt ist, wer wen, wann und zu was gebrauchen kann. Wird man nicht mehr gebraucht, ist man nutzlos. Unsere Ideale sind andere, aber unser Alltag ist in vielen Fällen bereits von dieser funktionalistischen Einstellung und von Lügen und Halbwahrheiten durchdrungen.
Wenn die Lüge salonfähig wird
Die Steigerung dieser Haltung ist die zynische Einstellung, dass es nicht nur hier und da kleine Schweinereien gibt, sondern, dass immer und überall gelogen wird. Nun ist das ganze Leben nur noch Strategiespiel und Menschen, die an etwas wie Vertrauen glauben, erscheinen als naive Träumer oder Spinner. Hauptsache, man erreicht sein Ziel, das ist es, worum es im Leben angeblich geht.
Aufrichtigkeit, Vertrauen und ein echtes Interesse für einander existieren in dieser Welt nicht mehr, was einerseits eine moralische Bankrotterklärung ist, aber andererseits auf einen Mangel an eigenem Erleben verweist. Wenn diese Haltung zu einer allgemeinen Einstellung in bestimmten politischen Systemen oder gesellschaftlichen Gruppen wird, so ist dies Ausdruck einer weit fortgeschrittenen Regression der Massen und wenn sich die Überzeugung vollständig durchsetzt, sind wir auf dem Durchmarsch zu einer faschistischen Einstellung, bei der es nur noch darum geht, sich mit allen Mitteln durchzusetzen, der Kampf, die Durchsetzung, die prinzipielle Überlegenheit zu demonstrieren ist alles, worum es geht.
Dass man sich betrügt, belügt und für eine kurze Zeit als nützlich ansieht, aber aber auch nicht mehr, ist dann normal. Es spricht viel dafür, dass eine grundsätzlich aggressive Einstellung scheitern wird, aber zu dieser dann meist in der Praxis gewonnen Einsicht wird viel zerstört und viel Zeit vertan.
Ideale werden selten erreicht, aber darum geht es auch nicht. Vielmehr dienen sie uns als eine Art Leitstern, an dem wir uns orientieren können. Dass wir irgendwo auf dem Weg sind, gehört dazu. Wenn Moral, komplexere Emotionen und Räume, in denen wechselseitiges Vertrauen wachsen kann zerstört werden, machen immer weniger Menschen, die Erfahrung, dass dies eine reale Erfahrung ist, die nicht zuletzt das eigene Leben bereichert.
Man muss nichts übertreiben. Notlügen sind in der Regel moralisch okay, wenn man sich klar macht, worum es bei ihnen geht. Etwa wenn man einen andere Menschen davor schützen will, bloß gestellt zu werden. Wenn man die Zusammenhänge zwischen intakten Objektbeziehungen, einem stabilen und integrierten Ich, dessen fester Teil immer ein, Wertesystem ist, das weder zu beliebig, noch perfektionistisch überfordernd ist, erkennt, dann wird vielleicht die Gefahr bewusst, in der wir seit längerer Zeit leben. Lügen und Halbwahrheiten erleben wir nicht nur in der Doppelmoral, die uns recht offen begegnet, sondern in der fortschreitenden Funktionalisierung unserer gesellschaftlichen Beziehungen, sprich, die letztlich fiese Unterteilung in nützliche und unnütze Menschen.
Es gibt in verschiedenen Ecken der Gesellschaft immer mehr Menschen, die das auf dem Schirm haben und für die ein respektvolles und symmetrisches Miteinander eintreten. Es wir viele Wege geben, sie werden eher kleinteilig und dezentral werden, die wachsenden globalen Krisen zeigen uns, dass wir zwar nicht gleich sind, aber im selben Boot sitzen. Lügen und Halbwahrheiten sind auch bei uns verbreitet, doch die Ideale leben noch, sind mächtig und an sie können wir anknüpfen.



