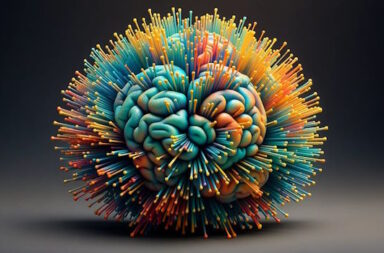So stellen sich manche unser Menschsein vor: Wir bekommen einen Impuls und geben ihn weiter.
Kant arbeitete die seltsame Kraft zur Synthese heraus, Hegel fragte, ob sie nicht ein riesiges Wunder sei und ihre explosive Rückseite viel ursprünglicher.
Die Kraft zur Synthese meint hier einen ‚Ort‘, an dem der unendliche Strom der Eindrücke gebündelt wird. Auf der einen Seite eine Banalität, die Dinge der Welt erscheinen uns als Einzeldinge: Autos, Katzen, Bäume und dem steht ein Ich gegenüber, was in die Welt schaut und dort eben diese Einzeldinge erkennt. Auf der anderen Seite ist das schon ein riesiges Wunder und es wird immer seltsamer, ja mehr man einzelnen Fragen nachgeht, über die wir im Alltag ganz problemlos etwas wissen. Etwa, dass eine Katze lebendig ist und ein Auto nicht.
Ohne dem groß nachzugehen, sind es Informationen, die uns dazu bringen, etwas als Katze oder Auto zuverlässig zu identifizieren und diesen weitere Eigenschaften zuzuschreiben, weil diese nun mal allen lebendigen oder motorisierten Einzeldingen zukommen. All das passiert im Ich, das die Bündel an Informationen abgleicht und passend zuordnet und von der Katze weiß, dass sie Wasser braucht und sich fortpflanzen kann. Vom Auto, dass es einen Motor hat und von denkenden Wesen für einen bestimmten Zweck gebaut wurde.
Das Ich hat zum einen diese Kraft zur Synthese, zum anderen besteht es aber auch selbst aus ihr. Denn was ist das Ich? Eine Reihe von Identifikationen, die man sich zuschreibt und um sie sich zuschreiben zu können, muss man sie auch anderen zuschreiben können. Wenn Petra sich anders erlebt als Paula, muss sie ja wissen, was bei ihr anders ist, sie muss also sich und Paula erkennen und unterscheiden.
Was uns auf der physischen Ebene oft noch spielend gelingt, misslingt öfter auf der psychischen und das ist eine reiches Thema für die Psychiatrie und Psychotherapie.
Ich und Gehirn
Eine auf den ersten Blick elegante Lösung besteht darin, dass Ich einfach zu etwas zu machen, was im Gehirn entsteht. Die Schwierigkeit bestand anfangs darin, dass man meinte, per bildgebender Verfahren bestimmte Bereiche identifiziert zu haben, in denen etwa Farbeindrücke oder Sprache verarbeitet oder ‚hergestellt‘ wurden, nur einen Ort im Hirn für das Ich fand man eigentlich nicht.
So griff man zuerst zur Dirigenten Metapher, das Ich sollte der Dirigent sein, die einzelnen Hirnareale das Orchester. In einer Welt materialistischer Erklärungsansätze, wie unserer, stellt sich allerdings die Frage, wo dieses Ich denn nun eigentlich sein soll, denn aus dem Off kann es schlecht Einfluss auf das physische Gehirn nehmen. Also erklärte man das Ich irgendwann zur Illusion, weil man keines fand, dann entdeckte man auf einmal wieder zehn oder mehr verschiedene, der halbwegs aktuelle Stand ist, dass man bei vielleicht 8 gleichzeitig im Gehirn verteilten Bereichen ist, die aktiv sind, wenn das Ich angesprochen ist.
Allerdings erklärt auch das nicht, wie die seltsame Kraft zur Synthese nun zustande kommt, wie man gute von schlechten Gründen unterscheidet, woher Logik kommt – ich kenne niemanden, der das aus Durchblutungssituationen oder selbstlernenden neuronalen Netzen ableiten kann – warum man von etwas überzeugt ist und gerade davon und nicht etwa vom Gegenteil, wann man Einwände gelten lässt und wann nicht und so weiter.
Und dann ist da eben dieser seltsame Punkt in uns, der, nachdem wir uns alle Vor- und Nachteile einer für uns sehr wichtigen anstehenden Entscheidung angehört und eine Nacht drüber geschlafen haben, uns diese Entscheidung treffen lässt und damit einen Strich unter die Sache zieht. Keiner weiß, wie das geht, aber wir alle wissen, dass es geht. Das ist ein fundamentaler Unterschied zur Gesellschaft und zu Systemen.
Man sagt immer gerne ein Land, eine Firma, eine Organisation habe sich entschieden. Nach demokratischen Spielregeln, sollten alle fair sein, den Wunsch der Mehrheit akzeptieren und mitspielen, als sei es auch der eigene Wunsch. Soweit das Ideal, das vielleicht öfter erreicht wird, wenn es gut läuft, aber im Krisenmodus verabschieden sich immer mehr aus dem System, wo dies möglich ist, sabotieren es oder leisten nur noch Dienst nach Vorschrift. Und eine 52:48 Entscheidung in einem System was nicht rund läuft, führt zu Lähmungen und Dysfunktionen. Anders beim Individuum: Man nimmt den Job an oder nicht, heiratet oder lässt es, man kann endlos hadern, aber bei den meisten Menschen ist mit der getroffenen Entscheidung der Weg frei.
Diese Entscheidung und der Weg zu ihr, all das Abwägen, die Gewichtung der verschiedenen Argumente, die dazu gehörenden Emotionen, so wie die grundlegenden Werte und Ziele eines Menschen, warum und wie jemanden etwas überzeugt, kann die Hirnforschung nicht erklären, neuronale Netze hin, Bildgebung und Statistk her. Die seltsame Kraft zur Synthese ist jedoch da, das sehen wir einfach an den Entscheidungen unseres Lebens, die nicht immer so wichtig sind, dass wir das große Besteck auspacken, aber wenn es nötig ist, können wir genau das.
Um behaupten zu können, dass das Ich nur eine Ausgeburt des biologischen Organs Gehirn ist und ganz und gar erklärend auf die dortigen Parameter zu reduzieren, müsste man deutlich mehr wissen, als es der Fall ist. Man weiß über die synthetische Kraft von dieser biologischen Basis aus, so gut wie nichts. Einen Ort hat man bislang nicht ausmachen können.
Die Weitergabe von Ideen
Wenn wir Nachkommen in die Welt setzen, so haben diese einige genetische Informationen von uns und wenn diese sich weiter fortpflanzen, bleiben unsere Gene der Welt erhalten, wenngleich sie sich immer mehr verändern, da jedes Mal ein Partner mit eingekreuzt ist. Ideen können jedoch auch weiter gegeben werden. In Form von Rezepten, Arten und Weisen etwas zu erledigen, zu schauen, auf Menschen einzugehen, aber auch in Texten, Lieder, Kunstobjekten.
Auch da bündeln und verdichten wir ja Ideen, etwa, wenn man in einer Karikatur mit wenigen Strichen den mit den typischen Äußerlichkeiten auch den Charakter eines Menschen erfasst und überzeichnet. Ebenfalls, wenn wir bereits kreisende oder irgendwie verstofflichte Ideen aufgreifen und auf unsere Weise interpretieren. Wenn ein Text oder Kunstwerk uns selbst inspiriert oder wir in der Ehe aus Mitgliedern verschiedener Kulturen eine Fusion herstellen.
Die Weitergabe von Ideen ist zugleich immer ein Akt der Interpretation, das heißt, etwas wird immer wiederholt und doch auf so eigene Weise interpretiert, dass es neu ist. Ein Paradebeispiel ist die klassische Musik. Seit Jahrzehnten spielen Orchester immer die selben Stücke: die Noten, Tonhöhe, Takt und weitere Vorgaben kann man nicht einfach ignorieren und doch sind die Interpretationen des Gleichen immer anders, so dass manche als Referenzwerke gelten und das nicht, weil man alle Noten richtig gespielt hat, sondern weil man einen bestimmten Aspekt in den Vordergrund rückte.
Manchmal öffnet man auch die Idee zu völlig neuen oder zumindest lange verschlossenen Räumen. Bei Hochsprung sprangen alle vorwärts über die Latte, bis der Amerikaner Dick Fosbury jene Flop-Sprungtechnik entwicklte, die sich bis heute gehalten hat. „Schon zehn Jahre davor war es Fritz Pingl, der diese Sprungart bei den österreichischen Leichtathletik-Meisterschaften zum ersten Mal vorstellte. Sie fand allerdings keine internationale Aufmerksamkeit, da Fritz Pingl nie an internationalen Meisterschaften teilnahm.“[1]
Kommen Ideen eigentlich aus uns?
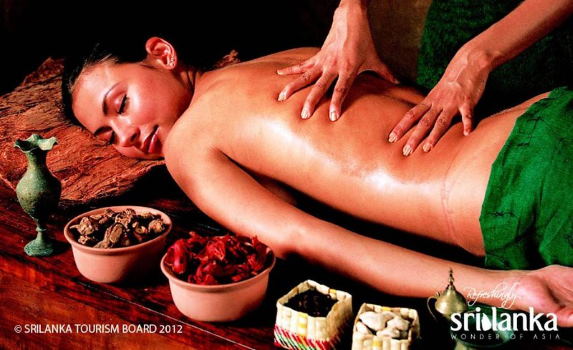
Wellness finden manche dekadent. © Amila Tennakoon under cc
Irgendwie schon. Aber so ganz ohne Zutaten geht es ja doch nie. Oft fügt man nur eine neue Komponente hinzu oder ändert einfach etwas die Perspektive auf ein Phänomen und schon sieht alles anders aus. Der Schritt vom Schöperglauben zur Wissenschaft ist so eine Perspektivveränderung.
Schaut man in die Welt, in der Annahme, dass sie ein Schöpfer ersonnen hat, so gibt es Grund zum Staunen und zwar reichlich. Haarfein auf einander abgestimmte Systeme, die so subtil und gleichzeitig so zahlreich sind, dass sich die fundamental überlegene Weisheit des Schöpfers geradezu aufdrängt.
Die Frage, ob man denn überhaupt einen Schöpfer annehmen muss, ist da fast ein Affront. Bis heute ist es nicht so ganz gelungen das Systemdenken von Resten eines Schöpferwillens zu befreien, ersatzweise unterstellt man der Evolution, dem Gehirn oder der Natur etwas zu wollen. Die Radikalität des naturwissenschaftlichen Denkens liegt darin, gar keine Absicht, gar keinen Zweck, Sinn und kein Ziel zu unterstellen. Alles nur Systeme, die sich auseinander ergeben, einfach weil das Universum sehr groß ist und 13,8 Milliarden Jahre eine sehr lange Zeit sind, in der allerlei passieren kann. Dadurch, dass irgendwo, im Falle des Lebens irgendwelche Nischen entstehen. Sie werden von der Vielfalt des Lebendigen sofort ausgefüllt, bis aller Platz vergeben ist, dann steigt der Selektionsdruck. Die Variante Nummer 3.785.272 irgendeiner zufälligen Mutation, erweist sich in einem bestimmten Umfeld als Vorteil, weil sie hilft, sich an ein spezielles Milieu anzupassen, so dass ein neu erschlossener Lebensraum für eine bestimmte Art entsteht. Da es hier keine Konkurrenz gibt, wird auch dieser schnell besiedelt, bis die Nische gefüllt ist, dann erweist sich irgendeine unter Millionen von Mutationen als Vorteil weil sie ermöglicht, sich erneut neuen Raum oder neue Ressourcen zu erschließen, weil sie besseren Schutz bietet oder anderer Möglichkeiten der Fortpflanzung oder was auch immer. Revolutionär ist, dass hier kein Plan vorliegt, sondern der Mechanismus stets Passung und Anpassung an aktuelle Gegebenheiten ist.
Das ist nicht unbedingt die Wahrheit, sondern einfach ein bestimmte Sichtweise, die das, was man erforscht in anderer Weise erklärt, als jene, die einen allwissenden Schöpfer annimmt. Auf einmal konnte man jede Menge Phänomene, sehr minutiös verstehen, die vorher im Verborgenen blieben. Das ist die Kraft zur Synthese in Aktion, man fasst bestimmte Ereignisse zusammen und behauptet, dass eine bestimmte Theorie sie besser erklärt, als eine andere, eine Art Evolution der Theorien, die auch so bezeichnet wird.
Eine eigene Idee, die man sich ausgedacht hat? Man kann es so sehen. Da sitzt jemand, grübelt über die Rätsel der Welt und findet eine Lösung. Manchmal geht es so, oft jedoch auch spontan, intuitiv, es scheint fast, als suche die Idee jemanden, der sie endlich erhört. Dafür muss man sich natürlich mit dem Thema beschäftigen, sonst übersieht man so manche Antwort, die vielleicht längst offen da ist.
Aber auch so kann man sich das Denken vorstellen, als eine Art Sinn, wie Gehör, Auge oder Geruch. So wie man einen Wald nicht selber macht, durch den man schreitet, sondern ihn einfach betritt, riecht und betrachtet, so kann man sich Ideen auch als eine Art innere Umwelt vorstellen, die man vorfindet und die anders ist, je nachdem, wohin man geht.
Wenn man seinen Empfinden für Wein oder Musik differenziert, dann trinkt oder hört man nicht mehr einfach so wie vorher, sondern man erkennt immer mehr Muster und Einrücke wieder, kann diese verbinden und Jahre später hat sich etwas verändert. Man ist ein Gebiet innerlich abgeschritten. Bei philosophischen Ideen ist es ähnlich. Man erkennt routiniert, was man vorher kaum sah, es entstehen innere Trampelpfade und später innere Gebäude, die man immer besser kennen lernt, weil man die Wege immer wieder abgeschritten ist.
Das ist aber nicht als Reaktion auf einen Außenreiz zu verstehen, auch wenn Wein und Musik natürlich auch Reize darstellen und philosophische Gedanken als Ausgangspunkt immerhin noch den Text oder die Ideen eines anderen haben. Doch ein wesentlicher Teil ist die Frage, was dann in mir mit diesen Reizen passiert. Das ist immer auch ein kreativer Akt, so wie ein Maler, aus einer Mischung von in paar Grundfarben große Kunst entstehen lassen kann oder weniger Gelungenes.
Doch gerade in der Kunst und manchmal auch in der Wissenschaft hört man, dass das Werk selbst – die Romanfiguren, die Melodien, das Bild – eine Art Mitsprache haben, einen eigenen Sog entwickeln oder mit einem Mal irgendwie fertig da sind, im Bewusstsein der Künstlers. Und wie ein großer Wein, spricht ein großes Kunstwerk oder ein bedeutender wissenschaftlicher oder philosophischer Gedanke nicht jeden an. Man kann bei der Begegnung achselzuckend dastehen oder ergriffen und erschüttert sein.
Abhängig davon, wie und wohin man die Aufmerksamkeit lenkt und damit zugleich dosiert von gewohnten Deutungs- und Betrachtungsmustern loslässt. Man spielt mit der seltsamen Kraft zur Synthese, in dem man lernt die Aufmerksamkeit zu richten, zu bündeln und zu lockern.
Psychologie und das Ende von Kausalketten
Oft sind wir weniger aktive Produzenten von Ideen als wir glauben wollen und zugleich verarbeiten wir weit weniger passiv Reize, als wir glauben wollen. Wir sind immer in Kausalketten eingebunden, es gibt ‚Material‘ mit dem wir arbeiten, doch wir haben als freie Akteure oft die Wahl, welche kausalen Stränge wir zusammenbinden und durch unsere prinzipielle Fähigkeit zur freien, bewussten Entscheidung sind wir Knotenpunkte im Weltenlauf, die nicht nur einen Impuls aufnehmen, wie ein Dominostein in der Reihe anderer, der dann, umfallend, den nächsten anstößt, sondern wir haben noch ganz andere Möglichkeiten.
Wir können wirklich neue Aspekte ins Spiel bringen, wir können bestimmte Muster abschwächen und andere verstärken und wir können Kausalketten, die über Generationen weiter gegeben wurden auch beenden. Das ist der Fall, wenn man aus einer Familie stammt, in der alle über Generationen Schuster wurden und man selbst arbeitet nun als IT-Programmierer.
Aber es gibt nicht nur diese offenen Kausalketten und Traditionslinien, sondern auch die Weitergabe von Traumata durch die Generationen, von Familiengeheimnissen und von unbewussten Mustern, die – unbewusst, aber tief sitzend – besonders hartnäckig sind, der Wiederholungszwang ist ein Klassiker. Freud nutze die seltsame Kraft zur Synthese um das Unbewusste systematisch zu erforschen.
Doch durch dieses Bewusstsein kann man die Stränge ändern. Es ist immer wieder eindrucksvoll zu sehen, dass es in Familien oder Gruppen bestimmte, unbewusst vergebene Rollen, Plätze im System gibt, in die bestimmte Mitglieder gedrängt werden: Die ewige Kranke, der Ungeschickte, die Außenseiterin, der Irre. Oft sind das Rollen, die sich niemand wünscht und man kann entweder diese Rollen allen am System beteiligten erläutern oder dem Betroffenen zeigen, dass und wie er sich dieser Rolle verweigern kann.
Besonders tragisch sind oft lange Traditionslinien von sexualisierter und anderer Gewalt. Tragisch deshalb, weil sie unbehandelt fast immer in irgendeiner Form an die nächste Generation weiter gegeben werden. Eine erfolgreiche Psychotherapie kann die unbewusste und oft ungewollte Weitergabe dieser Muster allerdings auch beenden. Eine wunderbare Möglichkeit, nicht nur für das Individuum, sondern für die Gesellschaft. Womit wir bei den Feinden der Kraft zur Synthese angekommen sind.
Ich oder Gesellschaft?
Es gibt mehrere Fraktionen, die auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun haben, die aber doch in einer übergeordneten Lesart verbunden sind. Ihre Motive sind etwas unterschiedlich und sie finden in unterschiedlichen Kombinationen zusammen. Kurz skizziert sind das der Szientismus, die politische Linke und der Kapitalismus.
Der Szientismus – grob gesagt der Verwissenschaftlichung der Welt, vor allem mit einer Betonung der Naturwissenschaften – teilt mit linken Ideen den Glauben daran, dass unsere Welt in aller erster Linie eine materielle Welt ist und auch als eine solche ausgedeutet werden sollte. So ist Physik die Basiswissenschaft, aus der manche meinen alles weitere ableiten zu können, die Psyche sieht man als ein Produkt (und letztlich als ein Epiphänomen) des Gehirns an.
Linke Theorien teilen den Materialismus, also nicht nur die Idee, dass das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein bestimmt, in dem Fall ist vor allem die Art der gesellschaftlichen Produktionsbedingungen gemeint, weshalb man meint primär diese verändern zu müssen. Der Kapitalismus steht linken Ideen natürlich diametral gegenüber. Der Kapitalismus verkauft Dinge, aber auch Ideen oder Dienstleistungen, er ist also nicht zwingend materialistisch in seiner Ausrichtung, aber alle drei genannten Bereiche sind funktionalistisch in ihrer Herangehensweise, einigen Linken darf man noch unterstellen, dass der Funktionalismus nur zeitlich befristet gedacht ist und sie die Idee, dass jeder zu seinen Bedürfnissen finden sollte ernst meinen, zu oft ist dies aber ein entindividualisierender Kollektivismus.
Kapitalismus und Szientismus gehen auch zu oft zusammen, in der Psychotherapie präferiert man dann auf den ersten Blick schnelle und effektive Methoden und pharmakologische Ansätze. Schnell, billig und man verdient noch daran. Ansätze die tiefer gehen, länger dauern und mehr in den Blick nehmen, gelten als umständlich und ineffektiv und werden auch mehr oder weniger subtile Art gerne lächerlich gemacht.
Auch Linke sind off auf Psychotherapie, aber auch auf Entspannungsverfahren und Meditation nicht gut zu sprechen, weil sie der Überzeugung sind, dass einzelne Individuen sich nicht wohl fühlen sollten, wenn andere leiden, das ist irgendwie nicht vorgesehen und gilt als ungerecht. Gerechtigkeit wird hier oft als gleichmäßige Verteilung der materiellen Güter und der gesellschaftlichen Posten verstanden. So werden Wellness, Therapie und Meditation als letztlich den Egoismus untermauernde Methoden angesehen, die dann unter schwerem ideologischen Beschuss stehen, wobei die Zeichen für die Linke nicht gut stehen. Ihre Stimme wäre an sich wichtig, auf dem aktuellen Niveau ist sie allerdings verzichtbar.
Natürlich ist es kein Fehler wenn einige Menschen voran gehen, ihr Wissen muss nur übersetzt werden. Es wird nicht allen im vollen Umfang zugänglich werden, aber das ist auch nicht nötig, weil nicht alle die gleichen Interessen haben.
Individuelle oder Systemveränderungen? Beide gehören zusammen
Auch die Aufforderungen die Geschichte der Welt aus Sicht der Materie, des Systemischen oder der Produktionsbedingungen zu betrachten ist nicht falsch, nicht mal, sie funktionalistisch zu sehen. Alles ist eine bestimmte Art der Betrachtung, sie war neu und wie oben beschrieben, revolutionär, im Vergleich zur Sicht davor. Doch sie scheint an ihr Ende zu geraten. Man ist dabei die letzten Reste auszupressen, doch es wird klar, dass die Dominanz der Erklärung schwindet. Der Funktionalismus ist überall auf der Welt dabei, sich die Menschen in seinem Sinne hinzubiegen, aber die Erfolge bleiben auch hier aus. Eine Krise jagt die nächste, auf sie wird immer nach dem gleichen Muster reagiert, recht erfolglos.
Eine erneute Veränderung der Perspektive würde helfen. Dabei geht es aber nicht nur um einen Blickwechsel, sondern mit und durch diesen werden neue Praktiken ermöglicht. Gerade in Krisen sind Selbstwirksamkeit und Resilienz Stärken, an denen sich andere aufrichten können. Doch es geht um weit mehr, nämlich um eine völlig neue Sicht auf die Welt und eine Lebensweise, die es uns ermöglicht bescheidener, dankbarer und glücklicher zu werden. Neben einer gewissen Trauerarbeit, die uns in die Lage versetzt von dem was wir hatten gebührend Abschied zu nehmen, brauchen wir die Kraft zur Synthese um das beste aus der alten Welt mit dem Neuen zusammenzuführen.
Quellen:
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Hochsprung#Techniken