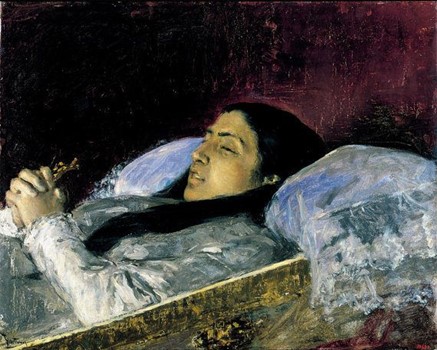Der Tod der Eltern ist immer ein einschneidendes Ereignis, doch eine besondere Dimension bekommt er für die Hinterbliebenen, wenn junge Eltern sterben. Dabei kann es sein, dass ein Elternteil stirbt, seltener kommt es vor, dass beide Eltern sterben, etwa bei einem Unfall.
Der Umgang mit Tod und Sterben
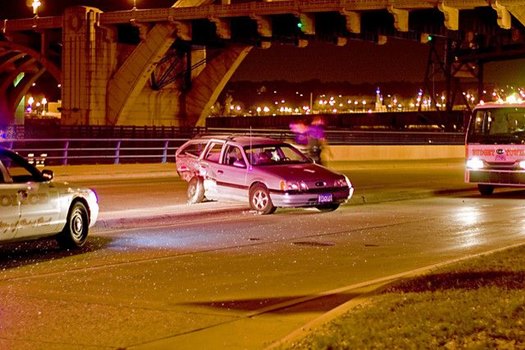
Wenn junge Eltern sterben, kann ein tragischer Autounfall die Ursache sein. © Jeremy Noble under cc
Der Umgang mit dem Tod ist wesentlich eine kulturelle Frage und unsere Kultur neigt dazu den Tod auszugrenzen. Trauer ist nichts für die Öffentlichkeit, man hat nicht das Bedürfnis sie öffentlich auszuleben, sondern wenn schon, dann hat man das im Stillen mit sich auszumachen. Nicht, weil man es selbst so möchte, sondern weil die Gesellschaft es erwartet. Dieser Befund von Philippe Ariès aus den spätern 1970er hat sich bis heute nicht groß geändert, eher ist es noch schlimmer geworden.[1] Genauer muss man wohl von einer Zweiteilung sprechen.
Auf der einen Seite steht die Erwartung, dass man schnell wieder funktioniert, was im Einzelfall, bei dem der nichts und niemand anderen hat, als seine Arbeit, sogar eine Stütze sein kann, auf der anderen Seite ist auch das ein Problem. Trauer kann heute nicht sehr gut geteilt werden, weil wir oft nicht mehr wissen, wie wir mit ihr und den Trauernden umgehen sollen. Die Trauer ist auf ihre Weise schon ein Akt der Verarbeitung und gerade die Psychologie weiß, dass verdrängte Gefühle nicht weg sind. Sie wirken dann nur im Unbewussten weiter und dort kommen sie auf ganz merkwürdige und neurotisch verzerrte Arten wieder ans Licht.
Wird die Mutter eines Jungen plötzlich aus dem Leben gerissen, so kann das dazu führen, dass er sich später, als Erwachsener, scheut feste Beziehungen einzugehen, von der heimlichen Angst getrieben, dass, wenn er sich wirklich emotional einlässt, ihm das Liebste im Leben wieder genommen wird. Eine Erfahrung, die der Junge kennt, die nur in der Zeit verirrt ist. Rational wird einem dieser Zusammenhang schnell klar, aber muss noch einmal durchlebt werden und dabei bleibt es nicht aus, dass die Trauer dann doch gefühlt werden muss, manchmal Jahre oder Jahrzehnte später. Besser ist es also, man lässt die Trauer zu, so gut wie es heute geht und deutet sie nicht zu schnell als Depression fehl. Trauer ist an sich kein Problem, es ist tatsächlich furchtbar traurig, wenn ein geliebter Mensch aus dem Leben gerissen wird. Die Vorstellung, dass dann nach zwei Wochen wieder alles in Ordnung sein soll, ist die eigentliche Absurdität, nicht die Trauer.
Das Problem haben Kinder weniger, da sie oft noch nicht wissen, was sich ‚gehört‘ und was erwartet wird. Für sie ist die Möglichkeit zu trauern, aber auch allen sonstigen Gefühlen Ausdruck geben zu können, besonders wichtig. Die modernen Formen der Psychotherapie sind in einem guten Sinne pragmatisch orientiert, das heißt, dass man einerseits darum weiß, dass Gefühle nicht verdrängt oder verleugnet werden dürfen, andererseits muss auch das Weiterleben klappen, denn darum geht es ja am Ende des Tages, auch in der Therapie.
Auf der anderen Seite nähern sich Teile der Gesellschaft den Themen Tod und Sterben wieder an, wollen Angehörige von sterbenden Patienten diese nicht in ein Hinterzimmer abgeschoben sehen, sondern in Hospiz- und Palliativnetzwerken und -stationen angemesssen und würdig versorgt wissen. Themen wie Sterbehilfe sind Teil ethischer Debatten, der Tod kommt also in einigen Bereichen zurück in unser Bewusstsein.
So in etwa ist die Situation hier und heute, eine Rückkehr der Beachtung des Todes, aber noch immer auf dem Boden einer breiteren Verdrängung in der jüngsten Vergangenheit.
Der Tod eines Elternteils ist immer ein Schock für Kinder, ein Trauma, was verarbeitet werden muss. Es gibt im Grunde keinen guten Zeitpunkt für den Tod der Eltern oder eines Elternteils. Jüngere Kinder können oft noch nicht erfassen, was es bedeutet, dass ein Elternteil nun einfach nicht mehr da ist und in seinem Fehlen ist der Verstorbene ja auch weiterhin im Leben anwesend. In Situationen wie Urlaub oder Weihnachten, in denen beim letzten Mal der Verstorbene noch dabei war oder natürlich am Geburts- oder Todestag des Verstorbenen ist man immer wieder an ihn erinnert. Jüngere Kinder sind noch unselbstständiger, brauchen ihre Eltern noch mehr, ältere Kinder mögen selbstständiger sein, blicken aber auf eine längere Geschichte mit den Eltern zurück und wissen, wen und was sie verloren haben.
Der plötzliche Tod beider Eltern
Das dürfte der seltenste Fall sein, dennoch kommt er vor. Verkehrsunfälle, Flugzeugabstürze könnten die Ursachen sein. Eine Tragödie für das Kind. Hier ist an erster Stelle dafür zu sorgen, dass das Kind in ein neues, stabiles Umfeld kommt und da ein plötzlicher Tod nie planbar ist, muss man dem Kind die Möglichkeit geben, durch eine dem Alter und dem Charakter des Kindes angemessene Form der Bearbeitung, irgendwie in Ansätzen zu verstehen und zu akzeptieren, was vorgefallen ist. Jedes Kind auf seine Art, auch das ist wichtig zu akzeptieren. Manche Kinder wollen in Ruhe träumen, andere wollen ihren Schmerz und ihre sonstigen Gefühle in Bildern oder beim Spielen ausdrücken. Neben Phasen der Ruhe oder des spielerischen Ausagierens in größtmöglicher Eigenverantwortung ist es wichtig, das Kind auch in eine neue Struktur und damit auch neue Aufgaben einzubinden. Das Leben des Kindes geht weiter und es muss im besten Sinne lernen auch ein normaler Teil der Welt zu werden, was bedeutet, auch eine psychische Struktur zu haben, vor deren Hintergrund die chaotischen Gefühle, die auftreten, wenn junge Eltern sterben, bearbeitet und sortiert werden können.
Es ist wichtig herauszufinden, wie das Verhältnis des Kindes zu den Eltern war, denn es kann sein, dass die Eltern das Kind sehr schlecht behandelt haben oder es kurz vor dem Tod einen großen Streit gab. Kinder neigen dann dazu, die Schuld für den Tod der Eltern, etwa, wenn sie aus Wut, Kränkung oder Enttäuschung Todeswünsche hatten, auf sich zu nehmen, weil sie glauben, dass der Wunsch, dass jemand sterben soll, auch konkrete Auswirkungen hat. Kinder in einer solchen Situation tragen diesen Schuldkomplex im schlimmsten Fall ein Leben lang mit sich herum. Auch für Misshandlungen seitens der Eltern übernehmen die Kinder oft Verantwortung, weil sie einerseits von ihren Eltern abhängig sind und mit der Situation klar kommen müssen, dass Menschen, denen sie vertrauen, sie misshandeln. Die Lösung der Kinder ist so gut wie immer, zu denken, dass es schon irgendwo berechtigt sein wird, dass man sie schlecht behandelt, dass sie irgendwiie böse Kinder sind. Diese Erklärung psychisch besser zu verarbeiten ist, als die Alternative, dass die Eltern, wahllos und willkürlich agieren.
Auch wenn diese Konstellation ein Sonderfall sein dürfte, sei er kurz erwähnt, weil die Auswirkungen gravierend sein können. Zunächst könnte man denken, dass das zu seltenen Situationen gehören könnte, in denen das Kind im Grunde froh sein kann, von einem Martyrium erlöst zu sein, doch gerade in diesen Konstellationen kann es geschehen, dass die Kinder sich schuldig dafür fühlen, dass ihre Eltern gestorben sind und das verschlimmert die ohnehin verfahrene psychische Situation noch einmal. Und in abgeschwächter Weise ist die kindliche Phantasie, die Eltern seien gestorben, weil man etwas falsch gemacht hat, bei jüngeren Kindern eher wahrscheinlich, als unwahrscheinlich.
Der plötzliche Tod eines Elternteils
Diese Konstellation wird häufiger vorkommen und wenn ein Paar Kinder hat, ist es vermutlich für den hinterbliebenen Elternteil und die Kinder gleichermaßen wichtig, einander zu haben. Irgendwie muss es jetzt weiter gehen, schon weil da noch jemand ist, für den man verantwortlich ist. Man ist nicht allein und das ist so gut wie immer ein Vorteil.
Mehr noch, als wenn beide Eltern sterben, ist der Verstorbene in dem Moment besonders anwesend, wo er fehlt. Denn jetzt ist die Erinnerung gleichsam verdoppelt und zu Anfang natürlich der Schmerz über den, der jetzt für alle Beteiligten etwas anders fehlt, an den jeder seine eigenen Erinnerungen hat. Es braucht seine Zeit, bis der Schmerz im besten Fall allmählich in Erinnerung übergeht und in das, was noch hätte sein können.
Hier kann eine Kultur der Erinnerung vom überlebenden Elternteil und von älteren Kindern gepflegt werden, die sicher auch schöne Seiten hat. Es besteht lediglich die Gefahr, dass der nun plötzlich aus dem Leben gerissene Mensch übermäßig idealisiert wird und einen immer einseitigeren Status zugeschrieben bekommt und auf diese Weise eine Lücke reißt, die nie wieder zu füllen ist. Der Wunsch den anderen nicht zu vergessen und ihn gleichzeitig nicht zu überhöhen, als Menschen im besten Sinne – mit Stärken und Schwächen – in Erinnerung zu behalten, ist die Herausforderung in dieser Konstellation, um nicht alle späteren realen Beziehungen an der Übermacht des nun nicht mehr anwesenden idealisierten Verstorbenen abprallen zu lassen.
Schwierig es noch einmal werden, wenn nach dem plötzlichen Tod eines Elternteils der Partner irgendwann eine neue Beziehung eingeht. Eine Situation, die irgendwo zwischen gefühltem Verrat, eigenem Recht auf ein dennoch erfülltes Leben (niemand sucht sich aus den Partner früh zu verlieren) und der vermutlich vernünftigen Frage, was der Partner wohl gewollt hätte, wenn er gewusst hätte, dass der plötzlich stirbt, liegt. Auch für das Kind kann dies noch mal eine Achterhahnfahrt der Gefühle bedeuten. Wenn Menschen sich wirklich lieben, ist es für sie ein hohes Ideal, dass es dem anderen gut geht und daraus kann man viele Antworten im Bezug auf die Gestaltung des weiteren Lebens abzuleiten.
Der Suizid eines Elternteils
Der Suizid hat für die Hinterbliebenen immer eine besonders traumatisierende Wirkung, nicht nur, wenn junge Eltern sterben. Es ist die Mischung aus Schock und Schuldgefühlen, der Frage, ob man selbst etwas hätte merken oder anders machen müssen, der lähmt und entsetzt, den Partner, aber auch Kinder kann diese Phantasie beschäftigen. Die besondere Rolle des plötzlichen Suizids sei hier nur wegen ihrer psychologischen Bedeutung besonderns erwähnt, sie ist nicht unser eigentliches Thema.
Der sich abzeichnende Tod
Eine ebenfalls emotional schwierige, aber natürlich andererseits am besten planbare Konstellation, die dadurch, dass sie planbar ist aber auch erst die Frage aufwirft, was man am besten tun sollte, wenn man weiß, dass das eigene Leben, nach menschlichem Ermessen zu Ende geht.
Wir betrachten hier Ereignisse, bei denen es keine Wunderheilung oder Spontanremission gibt, bei denen, der sich abzeichnende Tod nicht durch ein plötzliches Geschehen ist, bei dem jemand nicht mehr zu Bewusstseins kommt und sich Wochen oder Monate zwischen Leben und Tod bewegt, bis er schließlich stirbt. Wir betrachten hier Ereignisse wie die Endphasen von degenerativen Erkrankungen, bei denen man dem Tod immer etwas näher kommt, was streng genommen natürlich für uns alle gilt, auch das sollten wir nicht vergessen.
Die Sorgen des sterbenden Elternteils
Da sind zum einen die Unsicherheiten im Bezug auf das eigene Sterben. Erfährt man, dass man eine potentiell tödliche Erkrankung hat, wie Krebs oder eine neurodegenerative Erkrankung, tritt auf einmal der Tod in unser Leben. Er war und ist zwar auf eine Art immer da, kann aber gewöhnlich gut verdrängt werden. Nun zumindest ist er in Sichtweite, wird zum Thema, um was man sich kümmern muss, was schlechter verdrängt werden kann.
Die ersten Ängste drehen sich nicht selten um die Ungewissheiten, die mit Sterben und Tod generell einhergehen. Neben der Angst vor Schmerzen und Atemnot, ist es die Sorge um Hilflosigkeit, anderen eine Last zu sein und die Frage, wie es beim Sterben und dann im Tod ist. Ist alles aus und was heißt das? Geht es irgendwie weiter und was bedeutet das? In Die Angst vorm Sterben – Der Tod als Teil des Lebens und Was tun bei Todesangst? – Therapie und Tod, sowie den Folgeartikeln sind wir diesen Fragen ausführlicher nachgegangen.
Ohne das durchaus oft dramatische Ende des Lebens schönzureden und vorsätzlich unrealistisch zu sein, darf man in vielen Bereichen heute Mut machen. Schmerzen können heute vermutlich besser genommen werden, denn je, auch bei der Atemnot kann man viel machen, durch das Wechselspiel von Sedativa, Sauerstoffgaben oder Inhalationen, der Tod selbst bleibt der große Unbekannte und hier spielt die Weltanschauung eine entscheidende Rolle, der wir uns unten widmen. Doch immer mehr Menschen lassen sich zu Fachkräften im Palliativ- oder Hospizbereich ausbilden, sind um das Thema bemüht und können wenigstens auf dem Weg zum Tod helfen.
So bekommen andere Fragen, die immer auch mitlaufen mehr Gewicht, die sich teils um den Sterbenden, teils um die Angehörigen drehen:
- Werde ich vergessen?
Vergessen wird man aus verschiedenen Gründen nie und wer weiß, dass er stirbt, kann den Grad und die Art und Weise der Erinnerung zum Teil beeinflussen. Wir gehen später ausführlicher auf beide Aspekte ein.
- Wie kommen sie ohne mich klar?
Eine oft berechtigte Sorge, doch im Fall des langsamen Sterbens haben die Angehörigen bereits die Möglichkeit das Leben ohne den Kranken unter den Bedingungen einer annähernden Normalität zu üben, da der Kranke mit der Zeit oft weniger seinen familiären Verpflichtungen nachkommen kann. Vielfach wachsen Menschen unter neuen Herausforderungen über sich hinaus, oft schätzt man sie auch falsch ein. Die emotionale Lücke ist es, die am schwersten wiegt. Am ehesten kommt man dann mit ihr klar, wenn man es sich und anderen erlaubt zu trauern.
Eine entscheidende Wende beim Sterben
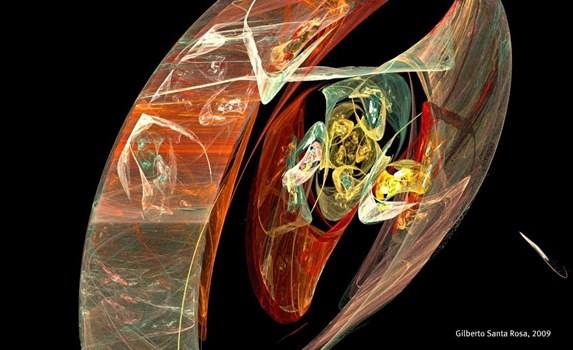
Wir wissen nicht, was uns nach dem Tod oder im Umfeld um das Sterben erwartet. © SantaRosa OLD SKOOL under cc
Menschen, die mit Sterbenden arbeiten, aber auch Sterbende selbst machen oft Erfahrungen großer Klarheit beim Rückblick auf ihr Leben. Das muss durchaus nicht immer traurig sein, auch wenn es große und anrührende Momente sind. Ich habe hin und wieder auch Kontakt zu Sterbenden und kann diese Erfahrung bestätigen: Wenn Sterbende sich erinnern oder sagen, was sie eigentlich noch vorgehabt hätten, was nun aber nicht mehr geht, geschieht das oft ohne Verbitterung. Eine milde Trauer, ein Bedauern ist zu spüren, wenn die nächste Chemotherapie zwar noch geplant ist, aber der Betroffene schon mit leiser Wehmut in der Vergangenheit spricht, oft von ganz einfachen Dingen des Lebens: „Dicke Bohnen, das war was … .“, sagte ein final krebskranker Patient mit dem Blick auf den Fernseher. „War“, hier hat jemand innerlich schon abgeschlossen, doch in der Rückschau war gleichzeitig noch einmal die Freude zu sehen, die er empfand, als er sich erinnerte, ein Strahlen überkam sein Gesicht.
Die Lebensbilanz von Sterbenden ist oft klar und nüchtern und wir könnten hier von ihnen lernen. Am Ende des Lebens ist die Botschaft dieser Menschen oft die, dass sie weniger arbeiten und mehr hätten wagen sollen, aber wir hören unseren Sterbenden nicht immer zu oder setzen ihre Erkenntnisse nicht um. Viele Illusionen, die man sich machte und wohl auch machen wollte, auch dann noch, als schon längst klar war, dass das Leben irgendwie anders läuft, als es mal geplant war, zerfallen wenn der Tod naht. Wohl auch deshalb wird in einem spirituellen Kontext oft die Zeit des Sterbens als besondere Zeit angesehen und auch Martin Heidegger (der freilich vom östlichen Denken beeinflusst war) sieht das Dasein wesentlich als ein Sein zum Tode an.
Eine entscheidende Wende bei Sterbenden ist, dass sie in einem bis dahin kaum gekannten Maß ihre Egozentrik verlieren und sich darum sorgen, wie es mit den Liebsten oder der Welt weiter geht, von der sie demnächst abtreten. Das Ich spielt in den aller meisten Fällen keine große Rolle mehr, wenn man sich bewusst wird, dass das Leben immer ein Geschenk war und ist.
Von einer sterbenden Mutter mehrerer Kinder ist mir bekannt, dass sie gezielt immer wieder auch einzeln und allein Zeit mit ihren Kindern verbrachte, um ihnen als einzelner Mensch (und nicht als „die Kinder“) gerade auch auch im Angesicht des Todes gerecht zu werden. Denn beide Seite profitieren von der Begegnung. Der Dienst am Sterbenden, sagt der Mediziner und Bioethiker Giovanni Maio, wendet sich am Ende zu einem Dienst des Sterbenden und so zu einem wechselseitigen Dienst am anderen.[2] Es mögen vielleicht nur Momente sein, in denen das gelingt, aber was am Ende des Lebens bleibt und zählt, sind Momente. Die wenigen bedeutenden Momente, die wir eingesammelt haben, für die es sich gelohnt hat zu leben.
Gegenüber Kindern sollte man so authentisch bleiben, wie man es ihm Leben auch sein sollte und ihnen die eigenen Gefühle zumuten, auch die schwierigen. „Es ist genug jetzt“, könnte so ein Gedanke eines schwer kranken Menschen sein, aber auch ein: „Ich wäre gerne noch länger geblieben und hätte dich aufwachsen sehen“, kann es sein. Auch der Partner des Sterbenden sollte über seine Gefühle reden, falls das gelingt und man überhaupt weiß, was man in dieser Situation fühlt. Es macht Sinn sich den Kindern gegenüber so zu benehmen, wie man es sonst auch tut und sie in den Sterbeprozess mit einzubeziehen, damit auch sie Abschied nehmen können und nicht darüber phantasieren müssen, was passiert ist.
Rituale erleichtern den Abschied
Rituale markieren oft den Übergang von einem Lebensabschnitt in einen anderen. Geburt, Hochzeit und eben auch der Tod werden bei uns noch rituell begleitet. Der sterbende Vater oder die sterbende Mutter verlässt dann die Gemeinschaft und wird beerdigt oder verbrannt. Die Vorstellung, was danach geschieht, ob überhaupt noch etwas geschieht oder ob alles vorbei ist, ist abhängig vom Glauben, in den jemand eingebunden ist und davon, wie stark jemand tatsächlich glaubt. Doch für die aller meisten Menschen, ist ein Ritual eine äußere und konkrete Begleitung einer inneren Wandlung, in dem Fall einer Wandlung zu einem Leben, das nun ohne den Verstorbenen weiter geht.
So kann man auch den Umgang mit der Leiche vor der Bestattung noch einmal neu überdenken, Carmen Thomas hat darüber ein schönes Buch mit dem Titel „Berührungsängste? Vom Umgang mit der Leiche“ geschrieben. Doch als Faustregel scheint mir richtig zu sein, auch diesen Moment nicht künstlich zu überfrachten, sondern grob gesagt so zu sterben, wie man gelebt hat.
Das Kind
Für das Kind ist der Tod eines Elternteils so gut wie immer traumatisierend. Gut wäre es, den Weg zu finden, mit dem das Kind kreativ selbst am besten umgehen kann, auch mit der Ambivalenz seiner eigenen Gefühle. Denn neben der fraglosen Trauer, gibt es weitere Emotionen, wie Wut auf den Verstorbenen, die ohnmächtige Wut, des: „Wie kannst du mich (ausgerechnet jetzt) verlassen?“ Dem Kind das Sterben oder den Anblick der Leiche völlig zu ersparen, ist vielleicht gut gemeint, aber oft nicht sinnvoll, weil gerade kleine Kinder dazu neigen darüber zu phantasieren, dass jemand doch noch lebt, wenn sie nicht sehen, dass er gestorben ist und man Kindern in früheren Zeiten und anderen Kulturen noch heute die Tod ganz selbstverständlich zumutete und damit auch zutraute, ihn zu verarbeiten.
Wie nah sollen Kinder den Tod des Elternteils erleben?
Es sind nicht unbedingt die schlimmen Bilder der Verfalls, der Schläuche, Kabel und Apparate oder der Anblick der Leiche, der den Kindern zusetzt, es ist eher der Verlust und die Abwesenheit des Elternteils. Wenn die Kinder klein sind und Zeugen einer chronischen oder schweren und fortschreitenden Erkrankung sind, dann kennen sie das eine Elternteil oft gar nicht anders als krank. Für Kinder ist das schnell Normalität, weil sie in jungen Jahren noch keine Vergleichsmöglichkeiten haben und sich zudem schnell anpassen können.
Auch emotional profitieren Kinder vermutlich meistens davon, wenn man ihnen nicht zu viel, vermeintlich wohlmeinend, erspart. Es macht in meinen Augen Sinn, Kinder – dem Charakter des Kindes und altersangemessen – die eigenen Gefühle des Sterbenden und des Partners miterleben und ihre eigenen äußern zu lassen. Das ist bei neurodegenerativen Erkrankungen vielleicht schwieriger, bei denen es am Ende zu schweren charakterlichen Veränderungen kommen kann, bei Krebserkrankungen ist man aber in aller Regel psychisch klar, auch wenn die Emotionen je nach Tagesform wechseln, wie das für Emotionen eben normal ist.
Man muss mit Kindern keine tiefen Diskussionen führen, aber man kann ihnen die eigene Ängste und Unsicherheiten im Bezug auf den Tod und das Sterben, aber auch die Sorge um ihre weitere Zukunft ebenso mitteilen, wie vielleicht Momente der Klarheit, der Schönheit und Ergriffenheite, der Erinnerung, die eben auch zum Leben eines Schwerkranken gehören, der nun auf einmal viel Zeit zum Nachdenken und Reflektieren hat, eine Zeit, die wir uns vorher selten nehmen. Das Kind hat die Chance den Menschen hinter dem Kranken noch einmal kennen zu lernen, auf eine ganz andere und vielleicht nicht mal schlechtere, weil präsentere Art, als im Alltag, wo es vielfach darum geht, zu funktionieren.
Authentisch zu bleiben und den eigenen Kindern etwas zuzutrauen, ist also eine gute Voraussetzung, im Leben, wie auch an der Schwelle zum Tod. Insofern sollte man auch ansprechen, dass man (höchstwahrscheinlich) sterben wird und dann für das Kind, nicht mehr da sein kann. Es kann auch offen darüber geredet werden, dass man dem Kind oder den Kindern vielleicht etwas hinterlassen möchte, was das sein und wie man das machen könnte, dazu am Ende des Beitrags mehr. Dem Kind neben den starken Seiten auch die schwachen zu zeigen, heißt auch, zu starken Idealisierungen vorzubeugen und die eine menschliche Seite hinter der immer auch etwas einsetigen Fassade des Kranken zu sehen.
Identität
Die Frage der Identität ist psychologisch nicht zu überschätzen! Sie beinhaltet ganz banal zunächst die Frage nach der Herkunft. Wir erleben immer wieder bei Adoptivkindern oder Kinder von Samenspendern, dass es ihnen immens wichtig ist, zu erfahren, wer ihre biologischen Eltern sind und Löcher oder auch nur Zweifel in der Biographie können zu schwerer Irritationen führen. Hitler und Stalin, die beide Verantwortung für die schlimmsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts tragen, haben neben der Gemeinsamkeit, dass sie beide am Syndrom des malignen Narzissmus litten, auch die Gemeinsamkeit, dass ihre Herkunft als unklar galt.
Egal ob dies historisch geklärt werden kann, die Unklarheit zur damaligen Zeit, während des Lebens der Betroffenen ist hier der springende Punkt und damit verbunden all die Mutmaßungen, das Gerede und das Misstrauen, das darum kreist. Natürlich neben anderen Faktoren, wie etwa schwerer Misshandlung.
Man möchte die Eltern kennen lernen, das ist das vitale Interesse der Kinder, früher oder später. Sich selbst zu verstehen heißt auch, die Eltern zu verstehen und diese zu verstehen, immer auch mehr über sich selbst zu erfahren und warum man tickt, wie man tickt. Dabei sind es längst nicht allein die biographischen Eckdaten, wie in einem Lebenslauf dargestellt, die übermäßig relevant sind:
„Vamik Volkan (1999) hat dargelegt, wie nationale Identität schon früh in die individuelle Ich-Identität durch Sprache, Kunst, Sitten und Gebräuche, Speisen und vor allem transgenerationale Weitergabe von Narrativen historischer Triumphe und Traumata als Teil eines gemeinsamen Kulturguts eingewoben wird. Die individuelle Vielfalt der Menschen, die sich im Umfeld des Kindes und jungen Erwachsenen bewegen und die durch gemeinsame kulturelle Traditionen verbunden sind, trägt so zur Stärkung der Ich-Identität bei: Die Beziehung zu unterschiedlichsten Objekten lässt unterschiedlichste Selbstrepräsentanzen entstehen, die über gemeinsame Merkmale verbunden sind und die im Zuge der Entwicklung […] integriert werden müssen.“[3]
Und bei Alexander Mitscherlich lesen wir:
„Zwar wird der Patient in der klassischen Psychoanalyse als Einzelner behandelt, aber unsichtbar sind mit ihm all die Personen, die Art ihrer soziokulturell geprägten Erziehung anwesend, mit denen er, im guten wie im schlechten, während seines ganzen Lebens mit der Ambivalenz seiner Gefühle, in Liebe und Hass, mit Bewunderung oder Verachtung verbunden war. Noch einmal erweitert sich der Horizont des Analytikers, wenn er sich fragt, zum Beispiel angesichts kollektiver Wahnhaltungen ganzer Nationen, wie es zur Ausbreitung solchen seelischen Verhaltens kommen kann. … Hier ist noch viel zu ergründen, denn man kann natürlich nicht eine Masse qua Masse zur Reflexion ihrer eigenen Position bringen.“[4]
Dieser Punkt soll nicht überstrapaziert werden, aber es soll sehr klar gemacht werden, dass Ich-Identität ein immens wichtiger Baustein einer gesunden Psyche ist und dass es eine dynamische Wechselbeziehung zwischen dem Individuum, den Eltern, der Peergroup, Vorbildern, aber auch der nationalen und kulturellen Identität gibt und dabei ist nicht nur wichtig, was erzählt und was ausgespart wird, sondern auch wie das passiert und wie in den unzähligen Alltagssituation auf was reagiert wird.
Das heißt, es gibt denn starken Wunsch der Kinder ihre Eltern und damit auch den Menschen hinter dem Kranken kennenlernen zu wollen, das dies ein Teil ihrer eigenen Identität ist. Schwer kranke Eltern können beruhigt sein, was den Punkt des Vergessenwerdens anbelangt, das Interesse und Verständnis für die Eltern steigt in aller Regel im laufenden Lebensalter der Kinder.
Niemals geht man so ganz
Es gibt verschiedene Vorstellungen und Arten des Weiterlebens:
Die psychologische Dimension
Wenn ein Angehöriger stirbt, dann empfinden die Hinterbliebenen „im Angesicht des endgültigen Verlustes des geliebten Menschen Trauer über all die Möglichkeiten […], die man mit diesem Menschen verpasst hat, die ungelebt blieben. Etwas, was man noch hätte sagen oder erleben wollen und was nun nie mehr nachzuholen ist. Dies veranlasst die Hinterbliebenen, als Reaktion auf die Trauer über das nicht Vollbrachte, bestimmte Dinge im Sinne des Verstorbenen zu tun, seine Ideen und Ideale hochzuhalten und, gerade jetzt, zu würdigen. In dieser Weise leben individuelle und typische Eigenarten und Sichtweisen des geliebten Menschen in anderen weiter. Der Verstorbene sorgt in gewisser Weise für die moralische Verfeinerung seiner Umgebung.“[5]
Der Verstorbene lebt also nicht nur in der Erinnerung an sein Fehlen, als Leerstelle weiter, sondern auf eine Art sogar intensiver als zuvor, weil es für die Angehörigen ein Weg ist, die eigene Trauer zu verarbeiten. Die Wünsche und Ansprüche eines verstorbenen Elternteils wiegen in aller Regel schwerer als die der lebendigen Eltern, bei Kindern vermutlich noch einmal anders, als bei Partnern, die einen langen, gemeinsamen Lebensweg hinter sich haben. Aber auch die Phantasie und Erinnerung an einen Menschen ist nicht wirkungslos, was psychologisch auf allen möglichen Ebenen immer klarer wird, gilt auch hier.
Die religiöse Dimension
Der Rest ist Glaubenssache, aber was, ob und wie intensiv man glaubt, hat durchaus einen gravierenden Einfluss auf das Leben und auch auf das Sterben. Die verschiedenen Strömungen der christlichen und muslimischen Glaubensrichtungen, mit denen wir es hier und heute vorwiegend zu tun haben, haben ihre jeweils eigene Vorstellungen von einem Weiterleben nach dem Tode, in einer oftmals besseren Welt. Für manche Menschen ist dieser Gaube noch lebendig und vital und hat eine tröstende und heilbringende Kraft, doch man kann den Glauben nicht verordnen.
Ein bedeutender Teil unserer Gesellschaft besteht aus Menschen mit konfessioneller Bindung, aber ohne starken Glauben und über ein Drittel der Bevölkerung ist konfessionslos. Auch Agnostiker und Atheisten haben verschiedene Ausprägungen ihres Glaubens, es wäre ein eigenes Thema hier die Vor- und Nachteile zu diskutieren. Unmittelbar einleuchtend ist, dass mit der Absage an einen Gott auch die Angst vor der Hölle, aber auch die tröstende Aussicht auf ein Weiterleben erlischt.
Eine weitere gar nicht so kleine Gruppe sind die Vertreter einer postmodernen Spiritualität. Eine Gruppe die ebenfalls heterogener ist, als man gewöhnlich denkt. Irgendwo zwischen den Extremen einer narzisstischen Verirrung, in der man denkt, man könne sich seinen Gott selber basteln und einer Rückbesinnung zur einer echten Spiritualität und Mystik, steht vermutlich eine breite Mitte von Menschen, die aus verschiedenen Gründen mit den Religionen nichts anfangen können oder wollen, aber irgendwie das Gefühl haben oder zumindest die Sehnsucht verspüren, dass es da mehr geben könnte oder sollte.
Die praktische Situation
Kinder wollen ihre Eltern verstehen, wenn nicht jetzt, dann später. Das lässt für sterbende Eltern die Frage aufkommen:
Was soll ich meinem Kind hinterlassen?
Wenn das Kind noch zu jung ist, um mit ihm in der Weise zu reden, wie sich der Sterbende das wünscht, dann könnte man ihm für spätere Jahre einen Abschiedsbrief schreiben, in dem man die Gedanken festhält, die das Kind betreffen und die gemeinsame Zukunft, die man nun nicht mehr hat, vielleicht aber gehabt hätte. Traurig ist der Tod ohnehin, aber es kann auch tröstlich sein, zu lesen, dass man einen Menschen an der Seite gehabt hätte, der gerne das eigene Leben miterlebt hätte.
Für das Kind ist es auch wichtig, den Menschen hinter dem Kranken kennenzulernen. Bei einer jahrelangen zehrenden Krankheit, meist aus dem Spektrum der neurodegenerativen, Autoimmun- oder Krebserkrankungen, kennt das Kind vielleicht bislang nur den kranken Menschen. Auch dort ist man Mensch, aber es eben nicht das ganze Bild. Wie waren Mama oder Papa eigentlich früher, als sie gesund waren? Was hatten sie für Träume, bevor die Krankheit alles veränderte? Waren sie stark, charismatisch, schüchtern, spontan? Was haben sie erlebt, von ihren eigenen Träumen eingelöst, was waren sie für Menschen, was hat sie interessiert? Waren sie neugierig und wenn ja, auf was? Oder selbstgenügsam? Haben sie viel gelacht und Spaß gehabt oder haben sie zu lange gewartet, um endlich mit dem Leben anzufangen? Wofür haben sie sich eingesetzt und was war ihnen nicht so wichtig oder egal? Was würden sie anders machen und was wieder genau so? Was sind ihre Eigenheiten gewesen, was haben andere an ihnen gemocht und was wurde kritisiert? Woran haben sie geglaubt, vor was haben sie sich gefürchtet, woran sind sie gescheitert?
In der heutigen Zeit hat man vielfältige Möglichkeiten Nachrichten zu hinterlassen, uns stehen neben dem Brief natürlich auch Ton und Bild zur Verfügung. Jeder kann selbst entscheiden, was er geeignet findet und vielleicht ist das Medium das Beste, bei dem am meisten von mir und meiner Persönlichkeit zum Ausdruck kommt. Tendenziell ist die Tiefe der Gedanken in Texten größer, wenngleich auch Bilder wichtig sein können. Je detaillierter und je ambivalenter umso besser, umso mehr kann sich das Kind später einmal mit dem Leben des Elternteils identifizieren und Teile davon bei sich erkennen. Das zu geschönte oder zu verfinsterte Bild wird da eher Probleme bereiten.
Vielleicht hat der sterbende Mensch früher gemalt, Musik gemacht, gedichtet, geschrieben. Ist es gut und zumutbar dem Kind das eigene Tagebuch zu überlassen? Vielleicht könnte man es zurück legen, bis zu einem späteren Geburtstag des dann möglicherweise jungen Erwachsenen. Andenken, wie ein Ring, eine Kette oder etwas, was man auf Wunsch bei sich tragen kann, können auch wichtig sein, als eine Art Talisman.
Mit älteren Kindern kann man reden und ihnen selbst die Wahl überlassen. Vielleicht gibt es etwas, was sie in besonderer Weise erinnert und was sie gerne als konkretes Andenken behalten würden. Oft können das ganz einfache Dinge sein, die die Kinder besonders an die Eltern erinnert, etwa solche, die in einer für das Kind besonderen Situation mit dem Elternteil eine Bedeutung gewonnen hat. Bei all dem sollte man das eigene Kind mit allen guten Wünschen begleiten, aber ihm doch auch genügend Raum zur eigenen Entfaltung lassen.
Keine Erwartungen, kein Fetisch, keine Bürden
Der nahende Tod ist immer auch eine Gelegenheit eigene Dinge in Ordnung zu bringen, sich unter Umständen noch einmal auszusprechen, zu erklären oder zu entschuldigen. Es ist schön und oft erlösend für das Kind, wenn Eltern das gelingt und fast wie ein Bann oder Fluch fürs Leben, wenn Eltern dazu nicht in der Lage sind. Es ist leider auch der Fall, dass Eltern das übersehen oder missachten, denn allein die Tatsache, dass jemand stirbt, macht noch keinen besseren Menschen aus ihm, auch wenn der nahende Tod so manches relativiert und die Prioritäten gerade rückt. Meistens ist es, wie oben beschrieben, so, dass die Egozentrik massiv abnimmt und eine auch für Betroffene als friedlich erlebte Stimmung eintritt. Im Fall starker pathologischer Verzerrung kann diese auch bis in den Tod andauern. Wenn sich Eltern jedoch schon aktiv Gedanken um die Zukunft ihrer Kinder machen, ist davon auszugehen, dass so ein pathologischer Fall nicht vorliegt, wenn es sich bei den Gedanken wirklich um das Wohl der Kinder geht und nicht um einen Mühlstein wie: „Mach‘ mir bloß keine Schande.“
Schön wäre es, wenn man die Zukunft des Kindes nicht mit allzu konkreten Erwartungen belastet. Natürlich wollen Eltern in der Regel das Beste für ihr Kind, aber manchmal gibt es eine Differenz zwischen dem, was Eltern sich als das Beste aus ihrer Sicht vorstellen können und was die Kinder selbst dazu empfinden. Insofern wäre es eine Belastung wenn die Wünsche eines sterbenden Elternteils zu konkret sind und doppelt unglücklich, wenn es sich um ein Elternteil handelt, das obendrein sehr stark idealisiert wird, weil man sich dessen Wünschen kaum entziehen kann. Daraus ergibt sich, dass weniger Idealisierung, wie schon erwähnt, die eine Seite ist und weniger Konkretisierung im Bezug auf die Zukunft die andere.
Wenn man dem Kind mitteilt, dass man sich freuen würde, dass es seinen Weg ins Leben findet, glücklich und erfolgreich in dem Maße und Sinne wird, wie es das später selbst als richtig empfindet, es den eigenen Idealen und dem eigenen Lebensweg entspricht und dass das Kind von allen guten Gedanken jetzt und in alle Ewigkeit begleitet wird, dann ist das vermutlich besser, als wenn es heißt, dass man erwartet, dass die Zahnarztpraxis übernommen und erfolgreich weitergeführt wird, um den Kontrast mal bewusst schroff zu zeichnen. So sollte man auch aus konkreten Andenken, wie einem vererbten Ring oder dergleichen tendenziell kein Fetisch machen, weil auch daraus ein Fluch werden kann, wenn das Andenken dann doch einmal verloren geht oder zerstört wird.
Doch wie jeder Mensch ist auch jede Beziehung zwischen Menschen einzigartig und so kann es Konstellationen geben, in denen ohnehin schon idealisierte Eltern oder die Nachkommen einer Familie, in der Tradition eine sehr große Rolle spielt, von genauen Vorgaben und emotional stark aufgeladenen Andenken sogar profitieren und daraus ihre Kraft zum Weiterleben und ihre Energie für Jahre ziehen. Das ist auch eine Typenfrage und sollte berücksichtigt werden, so wie abermals, wie sich das Kind, oder die Kinder mit den Eltern und dem bald sterbenden Elternteil verstehen.
Verstehen sie sich sehr schlecht, ist die Schuldfrage zu berücksichtigen, das heißt, es muss geprüft werden, ob die Kindern sich am Tod ihrer Eltern schuldig fühlen und es sollte ihnen altersangemessen klar gemacht werden, dass und warum das nicht der Fall ist. Werden die Eltern ohnehin sehr stark bewundert, kann es sein, dass ihr Einfluss über den Tod hinaus groß ist und die Kinder ohnehin versuchen, es ihren Eltern recht zu machen, das könnte Jahre später im Rahmen der normalen Entwicklung noch einmal ein Thema werden, wenn man versucht, sich von den Eltern innerlich zu lösen und seinen eigenen Weg im Leben zu finden.
Allgemeiner und wenn die Beziehung zu den Eltern normal gesund und nicht auf Bewunderung ausgelegt ist, hilft es den Kindern, wenn junge Eltern sterben, dass man ihnen in dieser ungeheuer schwierigen, traurigen und traumatiserenden Situation, ein ungefähres Gerüst gibt und der sterbende Mensch weder als Heiliger noch als nur Kranker gesehen wird und dem Kind die Möglichkeit zur Verfügung gestellt wird, das Elternteil nachträglich und nach eigenem Wunsch (der groß sein wird) kennen zu lernen, verstehen zu lernen und im eigenen Herzen lebendig zu halten.
Letzte Gedanken
Phillippe Ariès‘ Kraftakt über die Geschichte des Todes zeichnet nach, dass die Verknüpfung des Todes mit dem Bösen notwendig war um zum schamhaften Verschweigen des Todes zu gelangen, was wir heute noch immer kennen. Der Tod ist nach Ariès nie nur Privatsache, er ist immer auch öffentliches Spiel gewesen. Das änderte sich erst im 20. Jahrhundert, in den urbanisierten und technisierten Bereichen der westlichen Welt.[6] Erst wurde der Tod aus der Öffentlichkeit verbannt, später dann die Trauer, mit all den psychologisch absurden Folgen, die es bedeutet, wenn man nicht mehr trauern darf und Trauer als Depression pathologisiert wird.[7]
Die Situation die Ariès skizziert ist eine vor der wir heute auch und immer noch stehen. Einerseits wissen wir natürlich, dass am Ende des Lebens des Tod auf uns alle wartet (neuerdings gibt es allerdings wieder diverse auf Technik beruhende Hoffnungen und Versprechungen), andererseits wollen wir dem Sterbenden nicht den Gedanken zumuten, dass er tatsächlich sterben kann, denn dies könnte seine eventuelle Heilung beeinflussen. Die Hospizbewegung und Palliativstationen setzten hier einen Kontrapunkt, da sie gewissermaßen die Voraussetzung haben, dass die medizinische Kunst am Ende ist. Dort hat sich etwas getan, man reanimiert Patienten auch nicht mehr nicht zig mal, ohne jede Hoffnung auf dauernden Erfolg, also Genesung.
Aus der kleinen Elite, die Ariès beschrieb, ist inzwischen eine breitere Bewegung geworden, das Ziel was ihm hier vorschwebt ist „den Tod mit dem Glück zu versöhnen. Er soll lediglich zum diskreten, aber würdigen Ende eines befriedigten Lebens werden, zum Abschied von einer hilfreichen Gesellschaft, die nicht mehr zerrissen noch allzu tief erschüttert wird von der Vorstellung eines biologischen Übergangs ohne Bedeutung, ohne Schmerz noch Leid und schließlich auch ohne Angst.“[8]
Vielleicht ist das schon mehr, als man sich wünschen kann, aber nach zig Jahrzehnten einer unausgesetzten Entzauberung der Welt werden wir zu Zeitzeugen einer Entwicklung in der archaische Muster und moderne Lebensformen zusammenwachsen, an der Spitze der Forschung merkwürdige Erkenntnisse zustande kommen, wir uns wundern müssen, wie sich unsere Welt verändert, andere Skurrilitäten systematisch erforscht werden und es würde vielleicht weniger Menschen als noch vor Jahrzehnten verwundern, wenn auch über den Tod das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
Quellen:
- [1] vgl. Phillippe Ariès, Geschichte des Todes, Hanser 1980, S.742
- [2] Giovanni Maio, Medizin ohne Maß?: Vom Diktat des Machbaren zu einer Ethik der Besonnenheit, Trias 2014, S. 190
- [3] Otto F. Kernberg, Liebe und Aggression, Schattauer 2014, S. 330f
- [4] Alexander Mitscherlich, Der Kampf um die Erinnerung, Piper & Co. 1975, S.25
- [5] Carsten Börger, in Die moralische Verfeinerung – Karma und Psyche (2). Dort werden die Ideen zur Trauer aus Otto F. Kernberg, Liebe und Aggression, Schattauer 2014, S.262f referiert.
- [6] Phillippe Ariès, Geschichte des Todes, Hanser 1980, S.716
- [7] Phillippe Ariès, Geschichte des Todes, Hanser 1980, S.743f
- [8] Phillippe Ariès, Geschichte des Todes, Hanser 1980, S.789