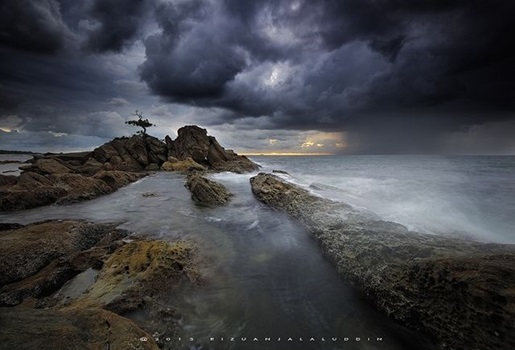Die Polarität, manchmal auch Dualität oder Dichotomie, ist ein modellhafter Versuch die Welt zu begreifen. Den Begriff der Polarität kennt man aus Natur- und Gesellschaftswisssenschaften, Philosophie, Psychologie, Religion bis hin in die Esoterik, die den Begriff popularisierte. Bei Wikipedia heißt es:
„Polarität ist ein Ausdruck der Philosophie für das Verhältnis sich gegenseitig bedingender Größen. Sie unterscheidet sich vom Dualismus, bei dem die Größen als antagonistisch (nicht miteinander vereinbar) gesehen werden. Bei der Polarität geht es nicht um einen unvereinbaren Gegensatz, sondern um ein komplementäres Verhältnis.
Eine Polarität besteht aus einem Gegensatzpaar und der Beziehung zwischen den Polen: hell – dunkel, kalt – heiß, schwarz – weiß, Mann – Frau, Liebe – Hass, arm – reich, krank – gesund usw., wobei einem einzelnen Pol nie eine Wertung (etwa gut oder schlecht) zukommt. Die Pole sind die zwei gegenüberliegenden Enden derselben Sache, untrennbar zu einer Einheit verbunden und bedingen einander. Tag lässt sich nur im Kontrast zur Nacht definieren, Heiß nur, wenn es auch Kalt gibt, keine Armut ohne Reichtum etc.“[1]
Eine der zentralen Fragen ist die, ob nun die Welt tatsächlich polar ist (das wäre eine ontologische Frage; Ontologie = Lehre vom Sein; wie es ist) oder wir sie nur so begreifen und uns erschließen können (eine epistemologische/erkenntnistheoretische Frage; in etwa die Frage, wie uns etwas erscheint und warum es uns so erscheint). Und natürlich, was es uns bringen soll, die Welt so, als Polarität, oder ganz anders zu begreifen.
Polarität und Pluralität
Bei uns hat sich eine etwas andere Sicht auf die Welt eingebürgert, nämlich die, dass Weltgeschehen nicht auf simple Polaritäten zu reduzieren sei, sondern alles in allem komplexer verlaufe. Zig Faktoren greifen ineinander, hemmen und verstärken sich gegenseitig, über die man am Ende dann meist nicht viel mehr sagen kann, als dass sie sehr komplex sind und dass bereits winzige Veränderungen (mindestens der Anfangsbedingungen) riesige Auswirkungen haben können.
Das bringt uns ein wenig in eine Position des ohnmächtigen Beobachters, der paradoxerweise ohnmächtig ist, weil er so viel weiß. Und im Grunde nur sagen kann, dass das irgendwie alles sehr komplex ist und dass man Supercomputer hätte, die all die Daten berechnen, aber wir wissen inzwischen, dass man sich auch da nicht so ganz sicher sein kann, weil die Rechenkraft zwar enorm ist, aber das Ergebnis oft eben auch nur so gut, wie die Komponenten die man hineinsteckte und hierarchisch gewichtete. Und das ist noch immer mehr oder minder willkürlich.
Wir haben es aber nicht so gerne, wenn man uns sagt, dass wir es eigentlich auch nicht so genau wissen, zumal zu den Versprechungen unseres wissenschaftlichen Zeitalters gehört, dass wir die Probleme die es gibt, alle verstehen und lösen können. Eine Idee ist dabei auch, dass Komplexität irgendwie stabiler und funktionaler ist, als simples.
Auf der gesellschaftlichen Ebene machen wir allerdings aktuell andere Erfahrungen. Komplexere Systeme kommen zunehmend in Schwierigkeiten und es profitieren die Vertreter einfacher Botschaften: Fundamentalismus, Populismus und Extremismus haben Aufwind, in Deutschland, Europa, weltweit. An Francis Fukuyamas Thesen vom Ende der Geschichte glaubt man heute nicht mehr und hat eher Angst vor einem Ende der Demokratie. Doch wie kommt das, nach dem alles so rosig aussah? Nun, die pluralistischen Erklärungen lauten, dass das eine sehr komplexe Gemengelage aus zig Faktoren ist und dummerweise kommen ziemlich unterschiedliche bis konträre Lesarten heraus, je nach dem, wie stark man welchen Faktor gewichtet und die Gewichtung ist nicht neutral, sondern eine weltanschauliche, auch wenn natürlich ständig das Gegenteil behauptet wird.
Die Erklärungen der Polarität sind im Grunde gar keine Erklärungen im klassischen Sinne, sondern eher eine Behauptung. Obendrein noch eine herausfordernd einfache Behauptung, die sagt, dass das Pendel hin und damit zielsicher auch wieder zurück schwingt. Dass wir mit anderen Worten in Rhythmusprozesse eingebunden sind, die mal größere und mal kleinere Amplituden haben, aber die im wesentlichen eben ein Rhythmusgeschehen abbilden. Das hat natürlich eine gewisse fatalistische Note, die wir nicht sonderlich schätzen, da wir zumindest gerne in der Illusion leben, dass wir unser Schicksal selbst im Griff haben. Und doch wissen wir nicht, warum nach Jahren der Ausbreitung von Demokratie und Marktwirtschaft, dem Glauben an das Ende der Mythen, Religionen und dem Siegeszug der Rationalität nun auf einmal so ein rapider Wandel eingetreten ist. Aus Sicht einer Weltanschauung die den Wechsel der Pole betont, im Grunde kein Wunder, fast eine Notwendigkeit. Je weiter man im Extrem des einen Pols angekommen ist, umso näher der Tag, an dem das Pendel zurück schwingt.
Polarität und Widerspruch

Die Regeln des Schwarms sind simpel und robust © Bernd Baltz under cc
Eine andere, ebenfalls bei uns verbreitete Lesart ist die, dass Pole notwendigerweise Widersprüche darstellen müssten. Entweder ich mag etwas, bin etwas, sage „Ja“ zu etwas, oder eben nicht. Aber so einfach ist es ja nicht und gerade in der Psychologie weiß man, dass Entwicklung und Humanität ganz wesentlich mit der Toleranz von Ambivalenzen zu tun hat. Zu deutsch: Etwas kann sehr wohl mit seinem vermeintlichen Gegenteil zusammen hängen.
Die Liebe ist vielleicht der schönste Spiegel, in den wir dabei schauen können. Der Mensch, den wir wirklich lieben ist automatisch auch der, der uns am meisten verletzen und auf die Palme bringen kann. Ja, Liebe und Aggression, Liebe und Wut, vielleicht in Grenzen sogar Hass, sind keine inkompatiblen Gegensätze, sondern fließen im anderen, den wir lieben zusammen. In dem Moment, in dem man die Liebe besonders intensiv spürt, ist kaum Raum für Wut da, aber wir wissen oft, dass der andere Pol nicht ewig weit entfernt ist und wenn einer Beziehung erlaubt wird stabil zu werden, wissen wir ebenso, dass die aktuelle Wut nicht das Ende der Welt und der Beziehung bedeutet, sondern, dass der Mensch den wir lieben uns größte Sorgen bereiten und Verletzungen zufügen kann und das ist das Wagnis, was es bedeutet, wenn man sich auf die Liebe einlassen will und kann.
Ein Gesamtgebäude
Wir haben uns aktuell eine äußerst merkwürdige Mischung angeeignet. Wir sind irgendwo davon überzeugt, dass es Fortschritt gibt und dieser Fortschritt durchaus bedeutet, dass unser Leben besser wird, gleichzeitig scheuen wir uns aber zu benennen, was wir unter besser verstehen, das wohl auch, weil jeder etwas andere Vorstellungen davon hat, wie eine bessere Welt denn nun aussehen soll.
Ganz polar und pluralistisch geht es jedoch darum, beide Sichtweisen zu vereinen. Es gibt zwar eigene Bücher und Weltanschauungen, die uns sagen, dass beide Pole wichtig sind, wir haben aber gelernt, dass es richtig ist, sich zu entscheiden und zwar für die Wahrheit und das Gute. Das klappt im Grunde auch ganz gut, solange wir ein klares und übersichtliches mythisches Weltbild haben, in dem richtig und falsch, Freund und Feind verlässlich zugeordnet sind. Es klappt, wenn alle einen Mythos – religiöser, politischer oder sonstiger Art – teilen und nicht zu viele kritische Fragen stellen. Darum sind mythische Gruppierungen auch nicht sonderlich an kritischen Fragen interessiert. Sie sind oft intolerant, aber durchaus stabil und schlagkräftig.
Aber wir wissen, dass kritische Fragen gestellt wurden und sich schon allein dadurch ergeben, dass es eben nicht nur einen Mythos auf der Welt gibt, sondern viele. Viele, vor allem inhaltliche verschiedene Mythen, so dass die Frage aufkam, was denn nun stimmt und wieso man, über den Zufall, dass man eben hier und nicht dort geboren ist, hinaus, unserem Mythos glauben sollte. Und so kam der Mythos in Bedrängnis, trudelte und stürzte – wenigstens in Europa.
Und auf einmal stand ein anderes skeptisches, wissenschaftliches Denken sozusagen dem Gesamtphänomen Mythos als Angebot gegenüber, so will es zumindest unsere Legende: die Wissenschaft. Und sie siegte auf ziemlich breiter Linie, vermutlich vor allem dadurch, dass man reichlich Praktiken entwickeln konnte, von denen die Menschen profitierten (vgl.: Die wissenschaftlich-technische Revolution). Und auf einmal war gar nicht mehr so klar, was gut und böse, richtig und falsch war, denn man konnte nun alles hinterfragen und tat das auch, mit großem Erfolg.
Aber irgendwann wurde auch klar, was die Wissenschaft nicht beantworten kann, nämlich Sinnfragen. Fragen, die uns Antworten auf das Warum und Wozu geben, denn das fehlte auf einmal. Man wusste prima, wie alles funktioniert und noch besser funktioniert, aber wieso soll man eigentlich funktionieren? Worum geht es eigentlich in dieser komischen Welt? Mit der Reihe über Weltbilder (hier der erste Artikel) haben wir zu zeigen versucht, dass die Antwort darauf von Stufe zu Stufe anders aussieht und dass der Kampf ums Überleben keinesfalls alles ist, worum es geht.
Wenn die Wissenschaft versucht auch auf diese Fragen Antworten zu geben, wird es fürchterlich und Wissenschaft zur Ideologie. Dann wird der Funktionalismus zum Ideal erhoben. Ideologen, die meinten im Namen der Wissenschaft zu sprechen machten sogar den Fehler, die Moral als Ganzes zu diskreditieren. Das taten vor ihr schon andere, aber nun kam das Ganze mit dem Segen der Wissenschaft daher. Doch 25 Jahre vorher erzählte die Esoterik schon dieselbe Geschichte:
„Der Atem ist ein gutes Beispiel für das Polaritätsgesetz: Beide Pole, Einatmen und Austamen bilden durch ihren ständigen Wechsel einen Rhythmus. Dabei erzwingt ein Pol seinen Gegenpol, denn Einatmen erzwingt Ausatmen usw. Wir könnten auch sagen ein Pol lebt von der Existenz seines Gegenpols, denn vernichten wir die eine Phase, verschwindet auch die andere. Der eine Pol kompensiert den anderen Pol, und beide zusammen bilden eine Ganzheit.“[2]
Hier ist die Polarität bereits ein Gesetz, aber ansonsten klingt das wie unser einleitendes Wikipedia Zitat. Und wie dort, wird auch hier das rhythmische Geschehen auf das Leben, die Wirklichkeit ausgedehnt. Und so wird auch hier sehr schnell gefragt, was denn nun eigentlich das Gute ist, wenn es das Böse nicht gibt und alles Rhythmus ist. Gibt es das Böse, im ontologischen Sinn? Oder brauchen wir nur den Kontrast, also das Böse um das Gute erkennen zu können, erkenntnistheoretisch? Wenn alle einigermaßen finanziell abgesichert, sozial anerkannt, nett und friedlich wären, wäre die Welt vielleicht kein Paradies, aber doch immerhin erträglich. Wären dann alle zufrieden?
Sind wir polare Wesen?
Die Grunderfahrung der Polarität ist der Atem, wie wir sahen. Aber das ist Esoterik. Was bietet die Wissenschaft? Von der Psyche gibt sie uns folgendes Bild: Wir kommen als Wesen mit Affektdispositionen auf die Welt, mit einigen Basisemotionen, fähig anhand dieser auf die Reize aus unserer Umwelt zu reagieren. Die einen schneller und heftiger, die anderen später und gelassener. Jede dieser Welterfahrungen ist für das Kind entweder angenehm, dann trachtet es danach diese Erfahrung zu wiederholen, oder unangenehm, dann versucht das deutlich aversiv reagierende Kind diese Erfahrung künftig zu meiden. Die Erfahrungen mit Welt lassen eine erste Polarität entstehen: Die Summe all dessen, was abgelehnt ist und dessen, was erwünscht ist. Gut und Böse sind so ganz ohne metaphysischen Überbau in der Welt, wenigstens in der Erlebenswelt.
Und das ganze Ziel späterer Entwicklung und Erziehung ist, diese erste Spaltung zu versöhnen, zu vereinen, zu integrieren und wenn das gelungen ist, hat das Kind eine neue Weltsicht erreicht, was die ersten Male geschieht, ohne dass das Kind überhaupt weiß, was eine Weltsicht ist, doch wissen wir aus Experimenten (vor allem von Piaget), dass es seine Perspektive dramatisch verändern kann. Dann ist das Kind auf einer höheren Entwicklungsstufe mit einer anderen Sicht auf die Welt und neuen Fähigkeiten und Möglichkeiten … und, so lehrt uns Ken Wilber, mit neuen Pathologien. Denn bestimmten Zweifel, Sorgen und Nöte treten erst ins Bewusstseins, wenn man bestimmte Stufen erreicht hat. Abschließend zufrieden ist der Mensch also nicht.
Und so sieht man sich wieder in einer Polarität, bestimmte Aspekte der Welt, gleich ob Innen- oder Außenwelt, treten einem wieder als fremd gegenüber, werden erst jetzt erkannt und wollen bearbeitet und integriert werden. Der polaren Sicht auf die Welt wohnt also eine eigene Hierarchie inne, mit unterschiedlichen Inhalten von Stufe zu Stufe. Und auch hier stellt sich auf einmal die Frage, was denn nun, die Rede vom Guten und Bösen wert ist, wenn das eine Frage der Entwicklung ist. Sind Gut und Böse dann nicht relativ oder noch deutlicher gesagt, einfach überflüssig?
Andererseits, wenn es höhere und niedrigere Stufen gibt, sind dann nicht die höheren auch besser? Wieder kommt es darauf an, was man als besser bezeichnet. Höhere Intelligenz ist nur dann besser, wenn man sie als solche bewertet, aber bei einem Betrüger würden wir uns vielleicht wünschen, dass er weniger intelligent ist. Das wäre besser, für uns alle, die wir nicht betrogen werden wollen. Also wäre etwas, was die Stabilität erhält gut? Sicher, in einem gewissen Rahmen mag das sein, aber irgendwann wird Struktur zur Erstarrung, die auf aller Kreativität und Lebendigkeit lastet wie Blei. Gut und böse/schlecht sind einerseits moralische, andererseits dynamische Größen, die sich je nach Situation verändern, aber natürlich wurde versucht daraus ethische Prinzipien zu extrahieren, brauchbar sind einige, unumstritten ist keines.
Schöpfungsmythen
Mythen und vor allem Schöpfungsmythen präsentieren oft ein polares Weltbild. Oft ist die Schöpfung ein Akt der Teilung und Zerstückelung, Schöpfen heißt Teilen, heißt, aus der Einheit eine Polarität zu machen: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“, lautet der Anfang, im alten Testament. Aber nur, um dann aus der Polarität wieder in die Einheit zu kommen. Auch die Einheit ist so ein gefährlicher Begriff, vor allem deswegen, weil es Denker gab und gibt, die die Existenz einer Einheit bezweifeln, Niklas Luhmann bezeichnete dies als „das alte, ontologische Denken“, und Markus Gabriel ist als ein Vertreter des „Neuen Realismus“ einer ähnlichen Auffassung.
Aber selbst wenn es eine Einheit gibt, könnte man fragen: Wozu das alles, wenn nach ihrem Erreichen alles so ist wie vorher? Und eine häufige Antwort ist, dass man auf dem Weg der Entwicklung von einer unbewussten tierhaften Eingebungenheit in die Natur, in der man noch nicht moralisch verwerflich agieren kann, weil kein Sinn für Moral vorhanden ist, in eine entwickelte Einheit kommt, in der man sich aus Einsicht beherrscht. Dann wäre Zivilisation das Ziel, weiter geht der Gedanke der Erleuchtung, bei der Regelkonformität gerade nicht das Prinzip darstellt sondern ein weiser Ausgleich der Pole das übergeordnete Ziel ist.
Yin und Yang
Die daoistische Lehre von Yin und Yang, fußt zentral einerseits auf dem Gedanken des Polarität und andererseits auf dem Dao oder Tao, das die beiden Pole vereint. Im I Ging, dem Buch der Wandlungen, ist die Dynamik der Polarität schön abgebildet. Man kann aus der Polarität deutlich mehr machen, als ein schwarz/weiß-Weltbild und Polarität ist mehr als schwarz und weiß. Aus der Vereinigung der Pole erscheinen neue Ebenen, aus denen sich wieder Polaritäten bilden, auch hier.
Aber was ist mit dem Dao, der Polarität zu den Polaritäten, der Einheit? Wenn wir mit unserem Denken an die Antwort herangehen, sind wir aus kultureller Gewohnheit eher unbefriedigt. Zu unkonkret, bzw., immer wenn man das Dao näher definieren will, zieht es sich zurück und im Daodejing (Tao te king) heißt es an mehreren Stellen recht lapidar, dass man, alles verfehlt und zerstört, wenn man das Dao zu fassen versucht.
Wir sind es gewohnt anders an die Dinge heran zu gehen und auch das ist nicht falsch, nur eben der polare Ansatz. Wir wollen es positivistisch, wollen klären, was gemeint ist, wenn wir einen Begriff verwenden. Das ist an sich auch gut, die Klärung der Begriffe ist eines der Hauptanliegen der Philosophie. Nur kennen wir eben auch Begriffe bei denen im ersten Augenblick und für den Alltagsgebrauch jeder weiß, was gemeint ist, aber wenn man die philosophische Maschine ankurbelt, wird es auf einmal nicht mehr so einfach. „Sein“, „Natur“, „Welt“ sind nur drei beliebige Begriffe, die unbestimmt sind, soll heißen, man kann auch etwas anderes darunter verstehen und keine Deutung hat sich endgültig durchgesetzt.
Nun kann man, wie man es zuweilen hört, ja auch sagen, dass die Philososphie und mit ihr die Gesellschafts-, Geistes- und Sozialwissenschaften ja eher diffus und unpräzise seien. Doch auch in der Biologie, der Wissenschaft vom Leben, ist der zentrale Begriff, nämlich „Leben“, nicht definiert. Und in der Basiswissenschaft Physik tobt der Streit seit Jahrzehnten, man kann den Welle-Teilchen-Dualismus noch immer nicht erklären und während die eine Gruppe meint, alle bedeutenden Physiker seien heute Quantenphysiker, meint das andere Lager gerade das Gegenteil, setzt auf die Mathematik und beides ist völlig unentschieden. Soll heißen, ein positivistischer Ansatz ist nicht falsch, nur an vielen Stellen eben auch nicht erfolgreich.
Polarität und Einheit
Vielleicht müssen wir uns gar nicht entscheiden. Vielleicht liegt auch hier die Lösung darin, ein weiteres Mal die Ambivalenzen zu ertragen. Vielleicht ist der Ansatz, dass wir uns immer richtig entscheiden müssen, selbst gar nicht richtig, sondern viel mehr der bewegliche Ansatz, der ein gleitendes Kontinuum darstellt. Aber eben, wie wir verstehen müssen, keine Willkür. Jede Situation ist anders uns so muss auch auf jede Situation anders reagiert werden. Das ist kein gefühliger Ansatz, der die Rationalität zurück weist, aber einer, der um ihre Grenzen weiß.
Je nach dem wie man Kant interpretiert, sagt er auch, dass man jede Situation neu bewerten muss, allzu starre Schematisierungen sind nicht gut, ethische Prinzipien weitaus besser. Das setzt wiederum auch der mythischen Interpretation Grenzen. Andererseits und wiederum polar, kann man althergebrachte Strukturen auch nicht einfach über Bord werfen. Der Konfuzianismus der annähernd zeitgleich mit dem Daoismus entstand, hat als eines seiner Kernelemente den Respekt vor den Ahnen. Das würde bei uns aktuell durchfallen, noch aktueller fragen wir uns jedoch, wie wir eigentlich mit unseren Alten umgehen. Respekt und Würde sind keine Begriffe, die wir mit unseren Alten verbinden, eher, dass oder ob sie dement werden, wer sich um sie kümmern soll und dergleichen.
Erzwingt ein Pol tatsächlich immer seinen Gegenpol? Das ist verlockend einfach und griffig. Zu einfach für viele, die dem Pluralismus deutlich mehr zutrauen. Doch eine Begründung hat die pluralistische Seite auch nicht parat, außer, dass in komplexen Systemen eben alles sehr schwierig und vielschichtig ist. Ich will das nicht lächerlich machen, denn es ist tatsächlich so, aber noch schwieriger ist, dass, selbst wenn wir Antworten theoretisch kennen, wir diese nicht immer praktisch umsetzen können. Vor wenigen Tagen hörte ich die Bemerkung, man wolle sich, im Hinblick auf die derzeitige politische Lage, nicht mit der einfachen Erklärung zufrieden geben, dass sich alle paar Jahre die Strömungen ganz einfach ändern. Was aber, wenn genau das der Fall ist?
Die Lösung für viele Probleme hieße dann: Abwarten und Tee trinken. Das passt nicht gut in unsere Zeit, die aktionistisch ist, in der man was machen, sich jetzt endlich engagieren muss, aber tun wir das nicht schon die ganze Zeit? Ist die Diagnose des Hamsterrades in allen Fällen verfehlt? Wir sollten es prüfen und je mehr wir dazu in der Lage sind, es vorurteilsfrei zu tun, umso besser. Es geht um unsere Fähigkeit zu erkennen: Wo erklärt der simple Ansatz der Polarität die Welt besser als ein pluralistischer Ansatz? Die Diagnose steht am Anfang und wenn wir zu der Überzeugung gelangen sollten, dass mit der Prämisse der Polarität des Soseins oder unserer Erkenntnisfähigkeit manches zu verstehen ist, kann man sich in den Systemen, die schon länger damit arbeiten umschauen, was weiter aus dem Gedanken folgt.
Dass ein Pol seinen Gegenpol erzwingt, ist ein für unsere Zeit herausfordernder bis kollektiv kränkender Gedanke, denn das würde oftmals heißen, dass allzu starke Bemühungen nichts bringen und man mit ihnen sogar das Gegenteil erreicht. Das klingt etwas fortschrittspessimistisch oder anders, es lässt den Fortschritt sich organischer entwickeln. Unser Ansatz ist eher problemlösungsorientiert, vielleicht aber auch hektischer. Man schaut, wo ein Problem ist, analysiert es und versucht Lösungen zu finden. Das ist alles kleinteilig, funktioniert aber ganz gut. Allerdings nimmt es wohl in letzter Zeit weniger Menschen mit, die das Gefühl haben, dass ein Teil einer immer effizienteren Maschinerie zu sein, nicht unbedingt das ist, was sie vom Leben erwarten. Denn der Mensch ist ja immer noch in Rhythmen eingebunden, die zunehmend ignoriert und durchoptimiert werden. Damit wir der Mensch wird zunehmend zum Fehler im System, einem System, dem er sich selbst verschrieben hat. Das Pendel schwingt nun vielleicht einfach zurück und zeigt und wohin der Hang zur Optimierung führt. Vielleicht müssen wir uns nicht entscheiden, sondern in die Mitte kommen, die Dinge ausbalancieren, in Ausgleich bringen, das raten uns ja die Systeme, die der Polarität eine Stimme geben.
Der Ausgleich
Wie könnte man das zu einer Einheit integrieren? Der Mensch ist schon in seiner Eigenschaft als biologisches Wesen einigermaßen polar. Rhythmen des Atems, Essen/Verdauung, Schlafen/Wachen, Anspannung/Entspannung greifen in uns ineinander. Dazu kommt die beschriebene Polarität des Affektsystems. Liebe und Aggression bedingen einander, schließen sich ebenfalls nicht aus. Selbst Wissenschaft und Mythos schließen sich nicht aus, erstens, hat das geschichtlich lange genug geklappt, zweitens, ist die Wissenschaft ebenfalls dabei Mythen zu entwickeln und drittens, gibt die Wissenschaft uns keine Werteorientierung, höchstens einen Effizienzglauben, aber genau unter dem leiden einige zur Zeit. Der Mythos gibt uns ein Ziel. Realität und Phantasie sind ebenfalls keine Größen zwischen denen man sich entscheiden muss, sondern sie bereichern beide unser Leben, vor allem, wenn es gelingt, sie klug auszubalancieren. Wie das geht, sollten wir erforschen.
Es gibt viele Bereiche, in denen wir darauf verweisen können, dass der Ansatz, gucken, analysieren, nachbessern prima funktioniert, aber die derzeitigen Spannungen kann man nicht negieren, am Gesamtkonzept stimmt etwas nicht und das, so wie es aussieht, gleich in mehreren Lebensbereichen. Nur was fehlt, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die einen erblicken dabei vor allem soziale Ungerechtigkeiten als Ursache und diese spielen sicher eine Rolle. Andere raten dazu den Blick eher nach Innen zu richten, auf die psychische und moralische Verfasstheit der Gesellschaft. Ich glaube, dass beides sich nicht ausschließt und dass man fragen kann, was uns eigentlich dazu gebracht hat die sozialen Ungerechtigkeiten und das Desinteresse an bestimmten Gruppen der Gesellschaft so lieblos und achselzuckend hinzunehmen. Für Gruppen, die wir als Außenseiter ansehen und von denen wir meinen, dass sie unsere Hilfe brauchen, haben wir in der Vergangenheit viel getan. Doch dabei haben wir den normal funktionierenden Durchschnittsbürgern in der Vergangenheit viel zugemutet und neue Ungerechtigkeiten kreiert. Es sind jene, die jetzt fragen, warum sich eigentlich niemand für sie interessiert und was sie eigentlich all die Jahre falsch gemacht haben, nur weil sie einigermaßen normal sind.
Der Blick ins Außen schließt den nach Innen nicht aus und erst wenn wir tiefer verstehen, dass gesellschaftliche Veränderungen auch unserer Psyche verändern und diese Entwicklung ihrerseits auf die Gesellschaft zurückwirkt, kommen wir wirklich weiter und das scheint mir ein die Polarität berücksichtigender Ansatz zu sein.
Quellen:
- [1] https://de.wikipedia.org/wiki/Polarit%C3%A4t_(Philosophie)
- [2] Thorwald Dethlefsen, Rüdiger Dahlke, Krankheit als Weg: Deutung und Be-Detung der Kranksheitsbilder, Bertelsmann 1983, S. 158